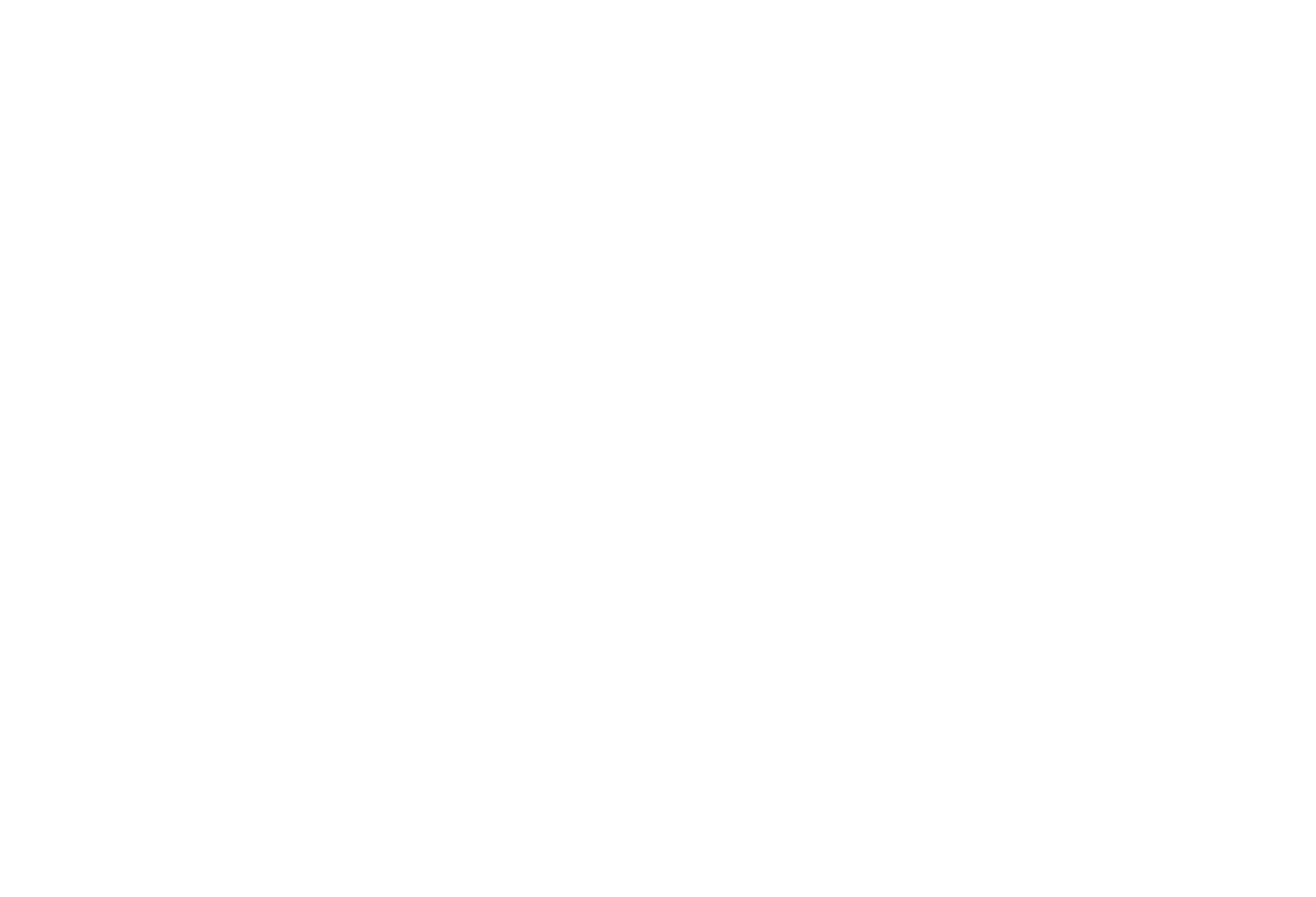„Unregierbar gemacht?“
Pandemie-Tracking und Datenpolitiken in autoritären Geflechten
DOI:
https://doi.org/10.15460/kommges.2023.24.1.866Schlagworte:
Digitalisierung, Autoritarismus, Digital-autoritäre Regierungsmacht, Pandemieüberwachung, Türkei, Datafizierung, Datenpolitiken, Corona-AppsRedaktion und Begutachtung
Abstract
In diesem Artikel stehen die Wechselwirkungen zwischen einer autoritären Präsidialregierung und dem Management von Pandemiedaten im Fokus. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der Datenpolitiken in diesem autoritären Kontext unter Einsatz von Hayat Eve Sığar (HES), dem türkischen Kontaktverfolgungs- und Proximitysystem sowie der dazugehörigen Anwendung. Ethnografisch werden die komplexen und sich ständig verändernden Landschaften viraler Daten erkundet. In diesem Zusammenhang wird verdeutlicht, wie die Frage der (Un-)Regierbarkeit inmitten der Pandemie durch die politische Gestaltung und Nutzung von Daten wahrgenommen, verhandelt und herausgefordert wird. Mit einem speziellen Fokus auf autoritäre Geflechte trägt dieser Beitrag zur Analyse von Datenpolitiken in digitalen, datengesättigten Gesellschaften bei. Autoritäre Geflechte, so das Argument, formen sich in Zeiten von Krisen wie der viralen Pandemie flexibel neu. Diese wirken subtil und schleichend auf die Machtverhältnisse im Zusammenhang mit Daten ein und beeinflussen die datenpolitischen Auseinandersetzungen, bleiben jedoch oft im Verborgenen.
1 Einleitung
Was passiert, wenn eine autoritäre Präsidialregierung auf ein pandemisches Datenmanagement trifft? In diesem Artikel gehe ich der Frage nach und analysiere die datenpolitischen Auseinandersetzungen im Kontext der Pandemieüberwachung in der Türkei. Die Covid-19-Pandemie wurde vor allem durch numerische und datenbasierte Informationen erlebt, noch bevor die breite Bevölkerung von der Virusinfektion betroffen war. Um sie effektiv zu bewältigen, wurden weltweit Datentechnologien in bisher ungekanntem Ausmaß eingesetzt. Diese umfassten den Einsatz von Smartphones, Tracking-Apps, QR-Codes, Proximity-Systemen und anderen digitalen sowie sensorischen Mitteln zur Überwachung, Kontrolle und Bekämpfung der Pandemie. Die türkische Regierung unter der Führung der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) reagierte auf die Krise, indem sie verstärkt auf Überwachungs- und Datentechnologien setzte und die Pandemie als ein digital zu steuerndes Phänomen kodifizierte. Im April 2020 führte das Gesundheitsministerium das Überwachungs- und Proximity-System Hayat Eve Sığar (HES) mit einer zugehörigen App zur Pandemieüberwachung und Datenverwaltung ein. Die Digitalisierung wurde als „Rückgrat des Kampfes gegen die Pandemie“1 proklamiert und HES als ein zentrales Instrument präsentiert, das in Echtzeit das Infektionsgeschehen verfolgen sowie den gesteigerten Bedarf an Echtzeit-Datenerfassung decken sollte. HES wurde als nationales Digitalisierungsprojekt bezeichnet und in die digitalen Dateninfrastrukturen von e-Staat und e-Gesundheit integriert. Es diente der Überwachung und Verwaltung von Pandemie- und Quarantänevorschriften sowie der Bereitstellung von Informationen und Daten. Jede*r Bürger*in wurde verpflichtet, einen individuellen QR-Code, den sogenannten HES-Kodu, bei sich zu tragen. HES erzeugte insbesondere in Verbindung mit der App und den obligatorischen QR-Codes kontinuierlich bewegungs- und personenbezogene Daten. Dies half, das Infektionsgeschehen in Echtzeit zu verfolgen, Metadaten zu generieren und zu verknüpfen, Risiken algorithmisch zu berechnen und die Ausbreitung des Virus zu kartieren. Es entstanden neue datenbezogene Verflechtungen und datenpolitische Entwicklungen.
Im Zuge der Krise wurde einmal mehr deutlich: Zahlen und Daten sind Träger von Lebenswelten und Politik. Sie prägen die (Un-)Regierbarkeit und auch den gesellschaftlichen Umgang damit. Ihr Existieren ist ebenso wie ihr Fehlen politisch. Als erste Pandemie datengesteuerter Gesellschaften (Milan, Treré & Masiero, 2021) ließ die Corona-Krise Fragen nach der Rolle von Daten im Hinblick auf die Verteilung von Mitteln und Instrumente zur Ausübung von Macht aufkommen. Das Ausmaß von Überwachung, Quantifizierung und Datafizierung, in die staatliche Institutionen und Regierungen investieren, wurde deutlich. Als biopolitische Eingriffe veränderten die staatlichen und technisierten Maßnahmen zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 nicht nur die Wahrnehmung von Staatlichkeit und Öffentlichkeit. Sie wirkten sich auch auf Machtgeflechte zwischen Technik, Politik und Daten aus. Dies war insbesondere im Hinblick auf die autokratische Aushöhlung demokratischer Strukturen und die autoritären Herausforderungen von Konzepten der (Un-)Freiheit, (Un-)Sicherheit und (Un-)Regierbarkeit von Bedeutung. Dabei spielten die digitalen und biopolitischen Verschiebungen eine erhebliche Rolle. Die rasant und kontinuierlich expandierenden digitalen, datafizierten Regierungssysteme waren daran maßgeblich beteiligt. Sie ermöglichen neue Formen der Überwachung, Verdichtung und Verteilung von Informationen und Daten. Zugleich initiieren sie Debatten über die digitale und datenbezogene Regierungsmacht – sowohl in demokratisch als auch in (soft-)autoritär regierten Ländern (Lyon, 2022; Polat, 2020a; Waisbord & Soledad Segura, 2021).
In diesem Artikel betrachte ich die Pandemie als ein besonderes „datenpolitische[s] Moment“ (Hoeyer, 2023, S. 183). Es machte die Bedeutung von Daten und ihren Technologien sichtbar, darüber hinaus, wie sie politische Machtgeflechte beeinflussen und neue Formen politischer Auseinandersetzungen ermöglichen. Damit schließt meine Analyse an „die Anthropologie der Daten“ (Douglas–Jones, Walford & Seaver, 2021) und kritische Datenstudien an, die sich mit Momenten und Folgen von „intensivierter Datenbeschaffung“ (Hoeyer, 2023), „Datenverflechtungen“ (Kitchin & Lauriault, 2014) und Konsequenzen der Datafizierung auseinandersetzen (Boellstorff & Maurer, 2015; Kitchin & Lauriault, 2014; Rottenburg, Merry, Park & Mugler, 2015). Anhand dieses Moments wurde ethnografisch greifbar, „wie Daten und ihre Technologien aufgenommen, umgesetzt und manchmal neu verwendet werden“ (Ruckenstein & Schüll, 2017, S. 265), ebenso, wie digitale und datenbezogene Regierung erlebt und ausgehandelt wird. Am Beispiel der Türkei konzentriere ich mich auf dieses Moment und erkunde ethnografisch Praktiken und Dynamiken digitaler, datenbezogener (Un-)Regierbarkeit während der Pandemie unter der Präsidialregierung der Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Es ist ein anthropologisches Engagement mit Datenpolitiken, das heißt Politiken von, mit und in Daten (Koopman, 2019; Ruppert, Isin & Bigo, 2017), unter schwierigen biosozialen und politischen Bedingungen. Um sie zu erkunden, tauche ich in die hochgradig politisierten Landschaften „viraler Daten“ – im doppelten Sinne der Viralität – als Vorstellungen von der Ausbreitung des Virus sowie von digitalen Informations- und Datenturbulenzen (Leszczynski & Zook, 2020; Polat, 2020a) ein. Empirisch stütze ich mich auf mein Forschungsmaterial, das ich in der Hochphase der Covid-19-Krise in den Jahren 2020 und 2021 teilweise aus der Isolation und via digitaler Kopräsenz einer Ethnografie in den eigenen vier Wänden generierte. Unter den pandemischen Bedingungen musste ich – wie viele andere auch – eine Art „experimentelles Eintauchen“ (Hine, 2017) in die digital und analog verflochtenen „überwachten Virus-Landschaften“ (Zurawski, 2020, S. 80) in der Türkei vollziehen. Neben der „#Ethnography“ (Bonilla & Rosa, 2015) zu den damals pandemiepolitisch relevanten Hashtags – darunter #hayatevesigar, #HesKodu und #Yönetemiyorsunuz (#youcannotgovern) – nutzte ich algorithmische Covid-Maps der HES als Methode, um die Datenlandschaften samt den in ihnen entstehenden und verankerten Politiken mit Daten zu erfassen.
Dieser Artikel ist wie folgt aufgebaut: Zunächst skizziere ich die theoretischen und empirischen Zugänge und erläutere meinen ethnografischen Zugriff. Danach beschreibe ich, wie die Pandemie in der Türkei auf autoritäres Regieren im Ausnahmezustand traf. Im empirischen Hauptteil analysiere ich, wie das Pandemiemanagement zu einem Politikfeld der Zahlen, Codes und Daten wurde und welche Rolle Datentechnologien dabei spielten. Drei wesentliche Aspekte hebe ich hervor: Erstens, HES fungierte ähnlich wie andere Tracking- und Proximity-Systeme als eine „soziotechnische Assemblage“ (Liu & Graham, 2021). Es koppelte Technologien, Infrastrukturen, Daten, Menschen und das Virus aneinander und erzeugte komplexe Landschaften viraler Daten, in denen die (Un-)Regierbarkeit der Pandemie erlebt, ausgehandelt und ausgefochten wurde. Zweitens, die Pandemieüberwachung wurde in die explizit autoritär-autokratischen – und nicht rein technokratischen – Politiken mit und von Daten eingebettet. Sowohl die Existenz als auch das Fehlen viraler Daten beeinflussten diese Politiken. Wie mein Material illustriert, prägte es auch die alltäglichen Erfahrungen mit autoritärer Regierungs- und Überwachungsmacht in Krisenzeiten. Im Gegensatz zum Mainstream-Verständnis ist diese Macht keineswegs absolut. Vielmehr beruht sie auf einer flexiblen Verflechtung von Regierungsstilen, Technologien, Biopolitiken, Diskursen, Institutionen, staatlichen und nichtstaatlichen Datenpraktiken und -infrastrukturen sowie populistisch-autoritären Unberechenbarkeiten, was ich als „autoritäre Geflechte“ (Polat, 2020b) verstehe. Drittens, und damit eng verbunden, waren diese Geflechte in viralen Landschaften besonders ausgeprägt. Im Laufe meiner Forschung konnte ich beobachten, wie sie die datenpolitischen Strategien der (kalkulierten) Unregierbarkeit durch das Zusammenspiel von autoritärer Unberechenbarkeit und pandemischer Ungewissheit prägten.
2 Relationale Zugriffe: autoritäre Geflechte, Datenpolitiken und Ethnografie
2.1 Von der Biopolitik zu Datenpolitiken
Die Corona-Krise rückte die Grenzen und die Schattenseiten der Digitalisierung als gesellschaftliches und sozialwissenschaftliches Problem in den Vordergrund. Digitales Regieren in Krisen- und Ausnahmesituationen gehörte in besonderem Maße dazu. Einschlägige Analysen problematisierten die pandemiebedingte Beschleunigung der Digitalisierung und Datafizierung von Gesundheits-, Sicherheits- und Krisenpolitiken. In Anlehnung an das Konzept der Biopolitik (nach Foucault) wurden dabei neue Formen digitalpolitischer Verschiebungen hervorgehoben. Es geht um Praktiken und Prozesse der Überwachung und Quantifizierung, die auf der Extraktion, Akkumulation und Analyse von (Personen- und Verhaltens-)Daten beruhen. Dabei wird auf die Ausweitung und Verfestigung diskursiver, infrastruktureller und informativer Macht privater Technologieunternehmen verwiesen, die in den vergangenen Jahren, insbesondere aber während der Corona-Krise, von Shoshana Zuboff (2018) unter den Begriff Überwachungskapitalismus gefasst wurden. Maschewski & Nosthoff (2022) attestieren eine überwachungskapitalistische Biopolitik. Am Beispiel von globalen Technologieunternehmen wie Apple beschreiben sie diese als Folge einer Ausweitung der „Wearable-basierten Infrastruktur(en)“, die „menschliche Verhaltens- und Vitaldaten in Datenbanken erfasst und bewirtschaftet“ und in einem „eindringlichen, kybernetisch orchestrierten Modus der Biopolitik“ endet (ebd., 442). Tragbare Geräte und Algorithmen bringen neue Sichtweisen von Individuum und Gesellschaft in Gesundheitskrisen hervor. In Datenbeziehungen lassen sich „signifikante Souveränitätsverschiebungen“ beobachten, die „den Einfluss der Konzerne und die Macht ihrer technischen Systeme realpolitisch erfahrbar machen“ (ebd. 2022, 488). Im Mittelpunkt steht die Frage, wie globale Technologie- und Datenkonzerne auf gesellschaftspolitische Krisenlösungen einwirken und wie dadurch die technischen und diskursiven Rahmenbedingungen „demokratischer Deliberation“ an den Fragen von Partizipation, Rechenschaftspflicht, Transparenz und Datensouveränität bis hin zur informationellen digitalen Selbstbestimmung manipuliert werden (können). Die durch die Pandemie beschleunigte Digitalisierung steuert demnach dazu bei, die oft undurchsichtigen Machtkonstellationen zwischen Techno-Unternehmen, Individuen und Staat zu verfestigen und die staatliche Macht auf überwachungskapitalistische Mechanismen und technisierte Kontroll- und Datafizierungsprozesse zu verlagern. In Foucaultscher Lesart verstehen sie Biopolitik als ein „Ensemble aus Handlungen, die sich auf mögliches Handeln richten“, als eine flexiblere Konstellation, die neue Techniken der „Regierung der Bevölkerung“ ermöglicht (Foucault, 2005, S. 256; Maschewski & Nosthoff, 2022, S. 442).
Solche Analysen konzentrieren sich auf die „technologische Seite“, so Liu & Graham (2021), das heißt auf die Interessen und Praktiken großer Technologie- und Datenunternehmen. Häufig werden die Folgen für (liberal-demokratische) Diskurs- und Handlungsräume analysiert. Die Dynamiken und Widersprüche in den Praktiken und Perspektiven von Menschen und Akteur*innen, die in unterschiedlichen soziopolitischen Kontexten mit Daten, Technologien und Infrastrukturen interagieren, werden dabei nicht angemessen berücksichtigt. Auf der „staatlichen Seite“ wird die datengetriebene Biomacht erfasst, die auf Mechanismen der Selbst- und Fremdüberwachung sowie der Datafizierung beruht. Es sind staats- und machtzentrierte Analysen, die staatliche Überwachungstechniken als biopolitische Steuerungsinstanz begreifen. Wie Lyon (2022) neben vielen anderen betont, handelt es sich um komplexe Mechanismen, die durch verschiedene Logiken und Technologien des Zwangs, der Überwachung und der Einflussnahme verwoben sind. Viele Regierungen handelten „in einer klandestinen Weise“ (ebd.). Sie fällten Entscheidungen hinter verschlossenen Türen, auch in Bezug auf die von ihnen gewählten Trackingmethoden und den Umgang mit Datenschutzregelungen, Privatsphäre, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Dadurch wurden Bürgerrechte, Freiheiten und Menschenrechte zurückgedrängt oder „gefährdet“ – sowohl in „demokratischen“ als auch in „autoritären“ Kontexten (Lyon, 2022, S. 135). Im Verlauf der Pandemie wurden die Politiken und Policies neu geordnet – obgleich in unterschiedlicher Intensität und mit variierenden gesellschaftspolitischen Konsequenzen.
Der allgemeine Rahmen der Gouvernementalität und Biopolitik suggeriert (neo-)liberale Logiken und Technologien der Regierung durch und von Daten. In den öffentlichen und wissenschaftlichen Diagnosen wurden zwei biopolitische Logiken einander gegenübergestellt: Die demokratische Biopolitik und die autoritäre Biopolitik (Sotiris, 2020). Im Kern ging es um eine an Foucault angelehnte Abschätzung der Folgen pandemischer Maßnahmen und Lockdown-Strategien. Sie stellten die Mechanismen der Disziplinarmacht und der panoptischen Maschinerie, das heißt der Einsperrung, der staatlichen Reglementierung, der Überwachung und der Quantifizierung in den Mittelpunkt. Zentral war die Frage, wie und auf welche Weise Praktiken der Überwachung und Quantifizierung den Ausbau repressiver Macht und autoritärer Tendenzen steuern und welche Rolle dabei überwachungskapitalistische Visionen und Logiken spielen. Dabei wurde die Tendenz deutlich, das Dilemma als eines zwischen autoritärer Biopolitik und liberalem Vertrauen in die rationale Entscheidung des Individuums zu simplifizieren. Solche biopolitischen Gegenüberstellungen implizieren Unterschiede in der Macht über Daten. Sie verweisen auf Praktiken, die demokratische Möglichkeitsräume im heterogenen, datafizierten Alltag und in der Politik einschränken oder ausweiten. Tendenziell rahmen sie allerdings datenbezogene Rechte wie die Macht über Daten oder das Recht auf Wissen als Privilegien, die über digital- und überwachungskapitalistische Datenwelten vermittelt und durch individuelle Praktiken, Datenschutzregelungen und datenregulative Rahmungen gewährleistet werden können.
Im Gegensatz zu einem zeitgenössisch-kritischen Analyserahmen, der dazu neigt, die Corona-Krise und die Pandemieüberwachung als Biopolitik, das heißt als Gesundheits- und Bevölkerungs-Management zu betrachten, konzentriere ich mich auf Datenpolitiken in einer global geteilten Situation. Aus sozial- und kulturanthropologischer Sicht ist die Regierbarkeit in die globalen Überwachungs- und Datenregime eingebettet. Zudem zeigt sie sich mit den „reduktive(n), fragmentierende(n), dekontextualisierende(n) Effekte(n) der Quantifizierung“ (Ruckenstein & Schüll, 2017, S. 266) verwoben. Daher macht die Analyse es erforderlich, über staats-, macht- und technologiezentrierte Perspektiven hinauszugehen (Kitchin, 2020; Kitchin & Lauriault, 2014) und die Regierbarkeit als bio-daten-politische Kapazität kritisch zu betrachten.
In Krisenzeiten geht es darum, was zählt und gezählt wird, um etwas (digital) regierbar zu machen. Die digital wie analog verflochtene Datafizierung der Krisen setzt dabei auf „mehr und mehr Daten“ (u. a. Big Data), begleitet von dem Credo, dass mehr Daten mehr Wahrheit bedeuten (Bell, Gould, Martin, McLennan & O’Brien, 2021). Daten, ob Big oder Small, sind seit jeher ein wichtiges Instrument von Regierungs- und Verwaltungsapparaten. Von der Steuerung bis zur Reglementierung (in Form von Volkzählungen, Bevölkerungs- und Geburtenkontrollen sowie Wahlen bilden sie einen festen Bestandteil von Regierungs- und Politikentscheidungen. Daten und neuartige digitale Technologien prägen die staatlichen Blicke auf Situationen und bilden dabei die Grundlage für die Rechtfertigung bestimmter Handlungen. Datenmacht geht über eine reine Dokumentation, Klassifizierung und Steuerung hinaus. Macht über Daten und Dateninfrastrukturen kann neue partizipative und antizipative Möglichkeiten bieten, aber auch die vorherrschenden Machtkonstellationen und Datenungerechtigkeiten festigen (Bell et al., 2021; Benjamin, 2019). Neue Systeme der Informationsüberwachung, -verdichtung und -verteilung fügen neue Komplexitäten zu dieser Macht hinzu. Auf eine neue Art und Weise knüpfen sie diese an die historischen und aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Partizipation, Transparenz, Souveränität und demokratischer Deliberation an.
In seinem Buch „How We Became Our Data“ beschreibt Colin Koopman (2019, S. 22), dass diese „ganz andere Operationen der Macht“ hervorbringen und „Info-Macht“ ändern. Biopolitik, wie Foucault sie verstand, kann diese Operationen und auch die damit einhergehenden Verschiebungen allein nicht vollständig erfassen. Sie sind weder auf die Politik der Disziplin noch auf die Biopolitik, die staatliche Souveränität oder die gängigen Theorien der demokratischen Deliberation reduzierbar. Stattdessen schlägt er vor, über überfrachtete Konzepte wie Biopolitik hinauszugehen und Verwobenheiten von Daten(praktiken), Politiken und Macht empirisch wie theoretisch anders zu erzählen. Datenregimes sind zu einem komplexen „Lebensraum“ geworden, in dem Menschen als „Datensubjekte“ besonders für den Staat systematisch „lesbar“2 gemacht werden. Andere, etwa Ruppert et al. (2017), fragen danach, wie Menschen in diesen Regimes zu „Datenbürger*innen“ werden, wie (unterschiedlich) sie mit der datenbasierten Selbst- und Fremdregierung umgehen und wie divers sie mit den ihnen inhärenten Politiken von Daten interagieren. Daten haben für sie „eine performative Kraft“; sie sind „Objekt[e], deren Produktion diejenigen interessiert, die Macht ausüben“ (Ruppert et al., 2017, S. 2). Im weitesten Sinne geht es um Data Politics, die in den kritischen Datenstudien zu einem neuen Forschungsfeld werden (Bigo, Isin & Ruppert, 2019; Koopman, 2019). Als Konzept bezieht sich Datenpolitiken nicht auf ein enges Verständnis von Praktiken im Bereich politischer und bürokratischer Situationen. Es geht auch nicht um datenbezogene Aushandlungen in politischen Institutionen oder in biopolitischen Staats- und Verwaltungsapparaten. Vielmehr werden Praktiken und Politiken als Teil von sozio-technischen Wechselbeziehungen untersucht. Gemeint sind die Politiken von, mit und in Daten. Koopman Koopman (2019, S. 38) sieht sie „so tief in uns verankert, dass wir dazu neigen, ihr Wirken meist nicht zu bemerken“. Andere zeigen, dass sie kaum unbemerkt bleiben. Besonders in Bezug auf Big Data – etwa in gesundheits- und krisenpolitischen Prozessen – können Daten erst „durch den performativen Prozess ihre eigene Politik“ (Blouin, 2020, S. 320) erhalten. Ihr Fehlen ist keine unschuldige Tatsache, sondern „ein politischer Akt und hat politische Konsequenzen“ (ebd., S. 323). Datenpolitiken finden sich nicht nur in staatlich generierten Datensätzen oder Projekten – beispielsweise E-Staaten, digitalen Punktesystemen (in China und woanders) oder algorithmischen Bürokratien. Daten werden gemacht, wenn sie „als Einsatz“ oder „als Repertoire“ strategisch mobilisiert sind oder „auf dem Spiel stehen“ (Beraldo & Milan, 2019).
In Anlehnung an diese Literatur richte ich den Fokus auf Datenpolitiken. Analytisch und empirisch folge ich den dort entwickelten relationalen Zugriffen auf Datenpolitiken. Dabei geht es, wie ich weiter unten ausführen werde, um die digital und analog verflochtenen Prozesse und Praktiken, in denen „Daten und Politiken untrennbar [miteinander verwoben] sind“ (ebd., S. 2). Daten und ihre Politiken traten uns in der Corona-Krise – ähnlich wie in früheren Krisen – in verschiedener Gestalt entgegen, manchmal als ein sinnvolles Werkzeug für Care oder für Rechte, manchmal als ein Fakt, ein Fake oder eine schwer regierbare Sache von Leben und Tod. Was machen Daten politisch und was macht sie politisch? Wie und in welchen Konstellationen von Macht, Technologie, Alltag und Krisen werden sie regierbar, verhandelbar oder gar gefährlich (gemacht)? Begünstigt oder verschleiert ihr Einsatz (soft-)autoritäre Aushöhlungen (liberal-)demokratischer Strukturen und Prinzipien? Unter welchen Umständen geschieht dies? Können daraus autokratische Konfigurationen entstehen? Diese Fragen stellten sich in einigen Kontexten mit größerer Dringlichkeit als in anderen. Sie lassen sich kaum unter biopolitischen Gesichtspunkten zum datenbezogenen Regieren beantworten. Auch der Fokus auf Datenpolitiken allein ist nicht ausreichend, denn er rückt Praktiken, Infrastrukturen und Vorstellungen von Daten in den Vordergrund, die mit Konzepten wie Datenschutz und Datensouveränität assoziiert werden oder überwachungskapitalistische Universalismen vermitteln. Wenn ich hier von Daten und ihren Politiken rede, dann geht es mir nicht nur um die Instrumentalisierung in einer viral und politisch schwierigen Situation. Vielmehr richte ich meinen Blick darauf, was ich als „autoritäre Geflechte“ (Polat, 2020b) verstehe.
2.2 Zu Datenpolitiken in autoritären Geflechten
In global und biosozial geteilten „Situationen“ (Zigon, 2015) treten diese Geflechte besonders sichtbar zutage. Die Covid-19-Pandemie betrachte ich als eine Situation, in der Datenpolitiken ethnografisch greifbar werden. Sie war durch globale Gefüge von digitalem Kapitalismus, staatlicher Überwachung, Grenzregimes, bio- und datenpolitischen Ökonomien und national-lokalen Realitäten geprägt. Situationen, wie Zigon sie am Beispiel von Drogenkriegen darlegt, zeigen „lokale Komplexität innerhalb der gemeinsamen Bedingungen“ und bringen die „fließenden“ und „emergierenden“ Machtkonstellationen zum Vorschein (ebd.: 501ff.). Diese Situationen stellen „totalisierte Assemblagen“ dar, die „Bedingungen für mögliche Arten des Seins, Handelns, Sprechens und Denkens“ prägen. Die Ethnografie viraler Daten(politiken) ermöglicht eine differenzierte Perspektive auf solche Situationen und auch auf die Verflechtungen von Praktiken, Technologien, Infrastrukturen, Gesetzen, Diskursen, soziotechnischen Vorstellungen, Machtansprüchen und Unberechenbarkeiten. In Anlehnung an den klassischen, mittlerweile vielfach benutzten Begriffe der Assemblage (Ong & Collier, 2005) und die assemblageartigen Zugriffe (Zigon, 2015) richte ich mein Augenmerk auf die wechselseitigen Verflechtungen von digitalen Technologien, Datenpolitiken, technokratischen Ansätzen, totalisierenden, auf Überwachung basierenden Biopolitiken und autoritär-autokratischen Praktiken wie Informationsmanipulation, antidemokratischer, willkürlicher und einseitiger Überwachung sowie Kontrolle, Verbot und Repression (Polat, 2020a, 2020b). Dabei setze ich digitale Überwachungssysteme wie HES zu Datenpolitiken im Kontext von Autoritarismus in Beziehung.
Der Begriff autoritäre Geflechte bezeichnet diese flexiblen und undurchsichtigen Verstrickungen, die auf verschiedene politische Felder und Situationen einwirken. Sie sind nicht starr, sondern flexibel und unscharf. Ähnlich wie soziotechnische Verflechtungen implizieren sie „Heterogenität, Kontingenz, Instabilität, Partialität und Situiertheit“ (Ong & Collier, 2005, S. 12). Sie sind weder Staatsapparate noch ersetzen sie einen repressiven oder demokratischen Staatsapparat. Zunächst unterscheiden sie sich darin, dass sie anders als Staatsapparate funktionieren. Sie sind durch kalkulierte Unberechenbarkeit, systematische Willkür, autokratische Manipulation, Desinformation und infrastrukturelle Hypermachtansprüche geprägt. Zugleich lassen sie strategische Prozesse, Praktiken und Ambivalenzen zu, die wir im Hinblick auf Partizipation, Teilhabe und Transparenz mit (liberalen) Demokratie(n) assoziieren. Sie können (soft-)autoritäre und autokratische Regierungsstile begünstigen oder deren Auswirkungen auf politische Situationen kaschieren. Überdies beeinflussen sie Macht über Daten und Datenpolitiken. So durchdringen sie die Politiken mit und durch Daten. Vor diesem Hintergrund schlage ich vor, Datenpolitiken in solchen autoritären Geflechten zu erkunden.
Die Assemblagen gründen auf „Politiken und Governance-Ansätzen [und entstehen] im Kontext von Technologieentwicklungen, im Aufeinandertreffen ganz unterschiedlicher Handlungslogiken und Weltsichten, oft auch konflikthaft, in Aushandlungsprozessen“ (Koch, 2018, S. 184). Sie umfassen nichtmenschliche Akteure wie Algorithmen, Geräte und Codes, die an der „Infrastrukturierung“ beteiligt sind (Amelang & Bauer, 2019). In meiner Forschung folge ich ihren (konstitutiven) Effekten für die (fragmentierten) Datenlandschaften, die sich in der Corona-Situation entfalteten und keineswegs für alle und jede*n gleichermaßen offen, zugänglich und greifbar waren. Daten und ihre Politiken treten daher als grundlegende, aber letztlich gewöhnliche Elemente größerer Verflechtungen in Erscheinung (Kitchin, 2020; Kitchin & Lauriault, 2014). Dabei greifen oft die technische und die staatliche Seite ineinander. Die Datenpolitiken sind in ihrer Verzahnung zwischen dem Digitalen und dem Analogen, dem Online und dem Offline, dem Politischen und dem Technischen, aber auch zwischen dem Gewöhnlichen und dem Außergewöhnlichen greifbar (für eine methodisch-analytische Diskussion siehe zum Beispiel Boellstorff & Maurer (2015); Knox & Nafus (2018)) . In ihrer Erforschung sind „mehr-als-digitalanthropologische“ Perspektiven entscheidend, „um einer wie auch immer gearteten techno-deterministischen Sichtweise“ (Klausner, 2022, S. 15) und überfrachteten Narrativen zu dystopischen und utopischen Effekten der Digitalisierung zu entkommen. Daten fungieren manchmal als ein „mächtiger Marker“ des Progressiven, manchmal aber auch nur als ein „leerer Signifikant“ (Geismar & Knox, 2021, S. 15), in dem sich hyperbolische Machtansprüche und utopische Hoffnungen manifestieren und vermitteln lassen. Ein Fokus auf die digital und analog verflochtenen Praktiken und Beziehungen ermöglicht „ein wichtiges Korrektiv“ (Klausner, 2022, S. 15) zu den Vorstellungen von Daten und zu den Analysen von Datenpolitiken. Dies ist gerade in ohnehin fragilen Demokratien und autoritären Geflechten von besonderer Bedeutung, um die Anordnungen des Datenpolitischen auf die Spur zu kommen.
Zahlen und Daten – sowohl generierte als auch geschätzte – sind politisch. Ihre Existenz und ihr Fehlen prägen die biopolitische Macht in Krisenzeiten und beeinflussen die erlebten ebenso wie die gelebten Wirklichkeiten, Wahrheiten und Widersprüche. Dies zu erkennen und strategisch zu nutzen, um in Krisen und Chaos für sich vorteilhafte Arrangements zu schaffen, ist vielleicht eines der typischen Merkmale zeitgenössischer Autoritärer. Die autoritären Regierungen erkennen, dass eine absolute Kontrolle über Informationen und Daten weder möglich noch notwendig ist. Sie beanspruchen eine hyperbolische Macht über Daten und inszenieren Datenlandschaften, in denen sie diese performen. Dafür greifen sie pragmatisch auf digitale Datentechnologien zurück. Sie wissen ihre Herrschaftstechnologien innerhalb der soziotechnischen Arrangements flexibel und willkürlich zu navigieren. Wenn es darum geht, sie und ihre Datenpolitiken in digitalen, datengesättigten Zeiten zu erforschen, stoßen wir an Grenzen – konzeptuell und methodisch. Charakteristisch für sie ist, dass sie die Grenzen zwischen demokratischen und antidemokratischen Regierungsformen und Biopolitik soft-autoritär (Randeria, 2021) ausdehnen und sie in autokratische Regierungsmacht umwandeln (Scheppele, 2018).3 Im Spannungsfeld digitaler Biopolitik und (Un-)Regierbarkeit in Krisenzeiten und gesellschaftlichen Ausnahmezuständen kommt dieses Charakteristikum besonders deutlich zum Vorschein.
Hier sind die oben dargestellten relationalen Ansätze hilfreich. Sie ermöglichen zweierlei: Datenpolitiken über eine Staats-, Macht- und Technologiezentrierung hinausgehend zu erkunden und ihre national-lokalen Formationen und Verstrickungen im Kontext von Autoritarismus nicht als von der Demokratie abgegrenzte Phänomene zu verstehen (Glasius & Michaelsen, 2018; Hou, 2022). Bisherige Forschungen konzentrieren sich auf einen „Staat-Markt-Komplex“ (Hou, 2022, S. 5). Dabei werden „die Überlegenheit und Stabilität autoritärer Macht nicht als selbstverständlich, sondern als eine prekäre Errungenschaft betrachtet“ (ebd., S. 5). Ähnlich wie in nichtautoritären Kontexten wirkt sich dieser Komplex höchst unterschiedlich auf die datengesättigten Alltage sowie auf Macht- und Handlungsfelder aus, um die sich zeitgenössische autoritäre Regierungen reißen. Dabei spielen digitale Regierbarkeit und bio-datenpolitische Verschiebungen eine entscheidende Rolle. Waisbord & Soledad Segura (2021) beschreiben beispielsweise für die lateinamerikanischen Länder das Fehlen einer (biopolitischen) Regierbarkeit. Dabei gelten verschiedene Faktoren wie Ziele und Wirkweisen bürokratischer Systeme, Regierungslogiken, Rechenschaftspflicht und die (fehlende) Transparenz von Mechanismen als wichtig. Zu diesen Faktoren zählen die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit digitaler Infrastrukturen. Ebenfalls spielen das Verständnis von und die Ignoranz gegenüber datenbezogenen Rechten wie der individuellen Privatsphäre, der Datensouveränität und des „Recht[s] auf Wissen“ eine maßgebliche Rolle (ebd.). Während der Pandemie konnten wir die Folgen in zahlreichen Ländern beobachten, darunter Ungarn, Indien, Russland, Israel, Brasilien und Mexiko. Die „digital-autoritären und illiberalen Praktiken“ (Glasius & Michaelsen, 2018) entfalteten sich rasant – nicht ausschließlich, aber insbesondere in autoritär-populistisch regierten Ländern. Sie umfassten orchestrierte Desinformation und möglicherweise auch „Sabotageakte“ (ebd.), die in großem Umfang durch Cyber-Truppen und mediale Operationen durchgeführt wurden. Die regierungsnahen Medien und digitalen Plattformen wurden für einen „Infokrieg“ genutzt – hier exemplarisch Brasilien unter Bolsonaro (Cesarino, 2021). Wie u. a. Sastramidjaja & Wijayanto (2022) beschreiben, wurden kritische Informationen und Daten zur Corona-Krise dadurch selektiv zurückgehalten, heruntergespielt oder manipuliert. In einigen Ländern – darunter die Türkei, Ungarn und Indien –, in denen die Exekutive und/oder eine einzelne Führungsperson über weitreichende Befugnisse verfügt, wurde die Veröffentlichung von den Angaben der Regierung widersprechenden oder diese hinterfragenden Informationen und Daten unter Strafe gestellt (Aydın-Düzgit, Kutlay & Keyman, 2021). Im Falle der Türkei ging dies Hand in Hand mit einer Machtzentralisierung, mangelnder inklusiver Regierung und Rechenschaftslegung. Der „public health centralism“ (Oztig, 2022) eröffnete zwar Möglichkeiten für ein besseres Pandemiemanagement, förderte jedoch gleichzeitig eine exklusive autoritäre Pandemiepolitik in Verbindung mit einer „Präsidialbürokratie“, die Bakir zufolge „Loyalität“, „Gehorsamkeit“ und „Engagement“ über professionelle Standards, autonomes Handeln und unabhängige Politikgestaltung stellte (Bakir, 2020, S. 429; zitiert nach Oztig, 2022, S. 265). Diese Faktoren prägten die datenpolitische Situation und ließen Fragen nach den Folgen exklusiver autoritärer Praktiken und Politiken im Zusammenhang mit Daten aufkommen. In meiner Forschung beschäftige ich mich ethnografisch damit und betrachte die Komplexität solcher datenpolitischen Situationen. Hier verwende ich „autoritäre Geflechte“ als heuristisches Werkzeug, um die Datenpolitiken in den vielschichtigen Verflechtungen von Regierungspraktiken, Machttechnologien, Infrastrukturen, Diskursen und politischen Strategien zu beschreiben. Daraus ergaben sich sowohl konzeptionelle als auch methodische Möglichkeiten und Herausforderungen. Im Folgenden werde ich einige von ihnen erörtern.
2.3 Erforschung viraler Datenlandschaften via Ethnografie von zu Hause aus
Ungewöhnliche Situationen verlangen nach experimentellen Ethnografien. Die Covid-19-Krise war eine davon. Ich saß in den vier Wänden meiner Wohnung in Bremen, einer norddeutschen Stadt mit rund 500 000 Einwohner*innen und einem damals als „vorbildlich“ dargestellten Pandemiemanagement, und versuchte, die pandemischen Umbrüche zu verstehen und vor allem den daten-bio-politischen Veränderungen in der Türkei nachzuspüren – eine Ethnografie von Zuhause aus, wie ich es während meiner Forschung in den Jahren 2020 und 2021 ironisch nannte, wobei ich auf die bereits erprobten Methoden der digitalen Ethnografie im Remote-Modus zurückgriff (Gray, 2016). In der Tat stellten sie, ähnlich wie vor der Pandemie, fast die einzige sichere Möglichkeit dar, beobachtend an den Geschehnissen teilzuhaben und digital ko-präsent zu sein. Auf diese Weise lassen sich politische und physische Gefahren und Risiken minimieren, auch wenn autoritäre Repression nicht vermeidbar ist (Glasius et al., 2018). Für mich, wie für viele andere kritische Wissenschaftler*innen und Forschende, die zur Türkei forschen, waren die Forschungsbedingungen bereits in den vorpandemischen Jahren schwierig.4 Ethnografische Forschung – ob online, aus der Ferne oder vor Ort – ist von autoritären Geflechten umgeben, durch die sie navigieren muss. In dieser außergewöhnlichen Zeit zogen sich die Fäden autoritärer Geflechte noch enger zusammen.
Um komplexe, dynamische Datenumgebungen in autoritären Geflechten zu erkunden, experimentierte ich mit einer assemblageartigen Herangehensweise. Zunächst beobachtete ich in Echtzeit Tweets mit den Hashtags #hayatevesigar, #HesKodu und #Yönetemiyorsunuz (#Ihrkönntnichtsteuern). Dabei erkannte ich schnell, dass es sich um hochpolitisierte Landschaften viraler Daten handelte, die sich nicht angemessen mit Fokus auf Hashtags erfassen ließen. In den digitalen Räumen gab es viele Diskussionen über Überwachungs- und Datenpraktiken, die durch HES entstehen. Zahlreiche Menschen äußerten Bedenken und Kritik an der Technologie, die ihnen zufolge staatlicher Überwachung und Repression Vorschub leistet und dem autoritären Staat ermöglicht, kontinuierlich Bewegungs- und Personendaten zu generieren, auszuwerten und unbegrenzt aufzubewahren. Technologien wie HES erzeugten „überwachte Virus-Landschaften“, wie Zurawski (2020) zutreffend beschreibt. Diese werden algorithmisch und in Echtzeit erfasst. Daher sind sie hochgradig dynamisch und ändern sich je nach Datenlage. Ethnografisch erweisen sie sich als nicht leicht zugänglich, insbesondere, wenn die Intention besteht, sie in einem autoritären Kontext mit digitalen oder fernethnografischen Methoden zu erfassen. Ich nutzte die sogenannten Corona-Maps, die HES in Echtzeit erstellte und der Bevölkerung per HES-App zur Verfügung stellte, um in diese komplexen viralen Datenlandschaften einzutauchen. In den Jahren 2020 und 2021 gewährten mir meine Gesprächspartner*innen virtuelle Durchgänge durch diese Maps (Abbildung 1). Dabei ließen sie sich auf offene Gespräche ein. Ich führte mehr als 15 Interviews mit unterschiedlichen Akteur*innen, darunter Nutzer*innen von HES ebenso wie Personen, die in die staatliche Überwachung integriert sind und/oder sich als Datenexpert*innen oder -aktivist*innen positionieren. Außerdem fanden 20 informelle Gespräche statt. Die Pandemie hatte eine viral geteilte, aber asymmetrische Situation zur Folge, in der meine Gesprächspartner*innen und ich uns mit unterschiedlichen Alltags- und Datenrealitäten befassen mussten. Sowohl in den sozialen Medien als auch in den Interviews, die ich führen konnte, war eine Mischung aus Vertrauen in Daten, Unbehagen hinsichtlich mangelhafter beziehungsweise manipulierter Daten und Angst vor datengestützter Überwachung spürbar.
Die virtuellen Durchgänge per HES-App zeigten, dass diese Landschaften komplex, schnelllebig und für viele – so auch für mich – schwer zugänglich waren. Ähnlich wie andere digitale Datenlandschaften sind sie von Macht, Wissen und fehlendem Wissen durchdrungen (Kitchin, 2014). Von Natur aus beinhalten sie Durcheinander, Unordnung und Probleme. Dazu gehören sowohl große Datenströme als auch Inhalte, Meinungsbilder und Narrative in sozialen Medien. Die Erforschung, ob digital, vor Ort oder in Remote-Kopräsenz, beruht auf dem Umstand, dass „die Feldstandorte oft verstreut sind, der Zugang ethisch fragwürdig ist, und die technischen Praktiken undurchsichtig sind“ (Douglas–Jones et al., 2021, S. 12). Pragmatisch musste ich mich auf eine Vielzahl von Quellen beziehen. So konnte ich beobachtend dem Geschehen auf digitalen Straßen, in sozialen Medien, Chatforen und WhatsApp-Gruppen folgen. Zudem griff ich auf digitale Daten zurück, die HES generierte und öffentlich zur Verfügung stellte. Dabei war ich zeitweise mit durch eine enorme und beschleunigte Generierung und Vermittlung der Daten geprägten Turbulenzen konfrontiert. Hier lagen Daten ungeordnet, „klobig [und] komplex“ vor (Biruk, 2018, S. 213). Wie Biruk betont, ziehen es Anthropolog*innen vor, „sich Zeit zu nehmen, unordentliche oder schmutzige Daten zu zelebrieren und Fragen nicht als abschließend beantwortbar zu sehen...sondern als Provokationen für neue Fragen“ (ebd.). Auch ich war für unordentliche und klobige Daten dankbar. Einzigartig an der pandemischen Situation war, dass virale Daten simultan überall unordentlich und klobig vorlagen. In meinem Forschungskontext waren diese Datenlandschaften durch autoritäre Geflechte geprägt, die sowohl den Zugang zu Daten sowie die Datenlage als auch die Beziehungen im Feld beeinflussten.
Meine Feldforschung stand – ähnlich, wie es auf die Forschungen in anderen autoritär regierten Ländern zutrifft – im Schatten autoritärer Macht, Willkür und Repression. Diese wirkten unmittelbar oder subtil auf das Forschungsfeld ein. Der undurchsichtige Staat-Markt-Komplex erschwerte den Zugang zur staatlichen und ebenso zur nichtstaatlichen Seite der Überwachungsindustrie (Hou, 2022). Dazu gehören die Effekte der explizit autoritären Überwachung und Repression sowie der mangelnden Transparenz und der zutiefst undemokratischen und vetternwirtschaftlichen Strukturen. Die an der Entwicklung und Implementierung von HES beteiligten Unternehmen, Institutionen und Akteur*innen, die die Datenpolitiken der Pandemie mitprägten, waren schwer zugänglich. Von staatlichen und halbstaatlichen Institutionen und Akteur*innen erhielt ich ständig uneindeutige Absagen. In den Gesprächen waren zudem unklare Aussagen enthalten, obgleich diese sie nicht dominierten. Des Weiteren ergaben sich spezifische Herausforderungen, die digitale Forschung in Online-Räumen und mit digitalen Werkzeugen mit sich bringt – nicht nur, aber besonders in autoritären Kontexten. Dass der digitale Raum unter medialer Inhaltsmoderation, Repression und Zensur durch den autoritären Staat steht, ist bekannt (Akarsu, 2020; Saka, 2016). Dementsprechend können weder Tweets noch Hashtags, weder Inhalte, (Sinn-)Bilder noch Daten repräsentativ für die politische Lage sein. Zwar bildete damals der Online-Raum die öffentliche Diskussion über HES und pandemische Überwachung ab. Sie war allerdings beschränkt, zumal der Staat gerade in dieser höchst politisierten Krisensituation die Macht über Daten und digitale Datenlandschaften beanspruchte – oft auch durch mediale Gewalt seitens AKP-naher Trolls und Cyber-Armeen, die einem Interviewpartner zufolge Plattformen sozialer Medien wie Twitter „sauber halten“. Er veranschaulichte dies mit der nun eingebürgerten Metapher „Infokrieg“. Die Präsidialregierung führt ihn demnach an „allen Fronten“ und bezweckt „Daten- und Inforeinigung“. Auch meine Forschung war durch diesen Infokrieg beeinflusst. Einige Tweets, die ich damals notieren konnte oder von denen ich Screenshots machte, sind nicht mehr verfügbar. Zu den technischen Filtern kamen angelernte Filtermechanismen hinzu, die sich die Menschen unter der schon über drei Jahrzehnte andauernden autoritären Herrschaft qualvoll aneignen mussten. Eine Interviewpartner*in gab beispielsweise in einem Online-Gespräch kund, „die Selbst-Zensur so weit verinnerlicht“ zu haben, dass sie ihre „Aussagen auf mehrere Folgen hin überprüft, ob ihr nur eine Strafanzeige oder Haftstrafe wegen bloß einer Äußerung oder einem Tweet droht“. Virale Datenturbulenzen beeinflussten außerdem die Forschung. Neben staatlichen Zahlen und Daten zum viralen Geschehen mobilisierte die Pandemieüberwachung eine Vielzahl von Datenquellen. Die denunzierten, echten oder falschen Fälle wurden zu Daten. Zivilgesellschaftliche Akteur*innen produzierten eigene Gegen-Daten und steuerten zur Komplexität viraler Datenlandschaften bei.
Was für unsere ethnografischen und digital-ethnografischen Methoden wie die Ethnografie allgemein gilt, trifft auch hier zu: Wir können nur Teile der Alltags- und Datenrealität abbilden (Bonilla & Rosa, 2015). Ich konnte – wenngleich lediglich in Ausschnitten – nachvollziehen, wie pandemische (Un-)Regierbarkeit in digitalen, viralen Datenlandschaften erzeugt, erlebt und angefochten wurde.
3 Un-Regierbarkeit der Pandemie: umkämpfte Datenlandschaften in autoritären Geflechten
3.1 Pandemie trifft auf autoritäres Regieren im Ausnahmemodus
Die Pandemie traf die Türkei Mitte März 2020 und stellte seither sowohl eine Krise der öffentlichen Gesundheit als auch eine Krise des „politischen Überlebens“ (Kirisci, 2020) dar. Sie zeigte, wie autoritäre Macht auf beiden Seiten „derselben undemokratischen Medaille“ operiert: existenzielle, ontologische Unsicherheiten und hyperbolische Macht- sowie Herrschaftsansprüche (Akkoyunlu & Öktem, 2016). Diese Macht muss immer wieder aufs Neue errungen und performiert werden, insbesondere in Krisenzeiten. Ähnlich wie von Autoritären anderswo in Europa und weltweit wurde die Pandemie zu Beginn auch vom Turkish-Style Präsidentialismus, wie ihn viele AKP-Abgeordneten bezeichnen, als eine „maßgeschneiderte Gelegenheit“ (Edelman, 2020) genutzt, populistische Wahrheiten zu verbreiten, Machtinteressen durchzusetzen und repressive Informationspolitiken auszudehnen (Halikiopoulou, 2020). Auf die gesundheits- und soziopolitischen Folgen der Pandemie reagierte die Präsidialregierung mit populistischen, nationalistischen und militärischen Krisen-Rhetoriken. Dabei setzte sie auf ein aggressives Regieren im Ausnahmemodus, das seit dem sogenannten Putsch-Versuch im Jahr 2016 Anwendung findet und sogar „eine gewisse Banalität“ aufweist (Gökarıksel & Türem, 2019).5 Die jüngste Literatur zeigt, wie besonders ab der zweiten Regierungsphase der AKP und schließlich unter dem Präsidialsystem eine Reihe „monströser Deformationen“ in politischen, rechtlichen und institutionellen Strukturen eingeführt wurde und willkürlich Rechte, Freiheiten und staatliche Rechenschaftspflicht entweder „entleert“ oder „ihres Inhalts und ihres Kontexts beraubt“ wurden (Küçük & Özselçuk, 2019, S. 8). Der autokratische Staatsapparat erfuhr eine Ausdehnung. Strukturen, die vor autokratischer Willkür, Unberechenbarkeit und Gewalt schützen, wurden hingegen systematisch abgebaut (Çalışkan, 2018). Gleichzeitig dient er dazu, existenzielle Unsicherheiten zu vertuschen und aus Krisen hyperbolische Macht- und Herrschaftsansprüche abzuleiten.
Die Pandemie offenbarte die Folgen. Sie förderte Missstände, Engpässe und Unordnung zutage, die durch die neoliberalen und autokratischen Umstrukturierungen während der AKP-Regierung in fast allen öffentlichen Bereichen entstanden. Das AKP-Stil-Krisenmanagement setzte auf die altbekannte „Alles-oder-nichts-Logik“, was laut den Politikwissenschaftlern Akkoyunlu & Öktem (2016) ein typisches Merkmal des türkischen Autoritarismus ist. Diese Logik zeigte sich während der Coronakrise bei regelmäßigen Ansprachen von Recep Tayyip Erdoğan an die Nation. Diese stellten die Türkei als ein Land der Superlative dar. Der „Prozess [wurde] bestens vorbereitet“ und ein „vorbildliches Krisenmanagement (örnek kriz yönetimi)“ war sichtbar. So lobte Erdoğan die „ausgeglichenen Politiken“, „technologischen Fortschritte und Infrastrukturen“ und „den öffentlichen Dienst in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor“, etwa mit der „stärkste[n] und am weitesten verbreitete[n] allgemeine[n] Krankenversicherung, [den] modernsten Krankenhäuser[n] und [den] höchsten Standards der Servicequalität der Welt“.6 In dieser hyberbolischen Darstellung wurde eine Strategielosigkeit klar. Die Bevölkerung war oft mit zentralen Entscheidungen Erdoğans konfrontiert, die praktisch über Nacht und vielfach ohne Konsultation oder trotz anderslautender Stellungnahmen von Expert*innen fielen. Sie traten mit sofortiger Wirkung in Kraft und sorgten eher für zusätzliches Chaos.
Transparenz wurde zwar als eine Schlüsselkompetenz dargestellt. Die Kritik an einem Mangel in diesem Bereich war jedoch noch nie so laut wie während der Pandemie. In einer Analyse behauptet Kisa (2021), dass die Pandemiepolitik darin bestand, Informationen zurückzuhalten und die Schuld auf alle anderen zu schieben.7 Zahlreiche Journalist*innen, Aktivist*innen, Menschenrechtsanwält*innen und Mediziner*innen wurden wegen ihrer Berichtserstattung und Enthüllungen zur Coronalage ins Visier genommen, inhaftiert oder waren gefährdet. Das „Authoritarian Playbook“ wurde strategisch für mehr Willkür und unberechenbare Gewalt eingesetzt, wie Freedom House zum Umgang mit der Pandemie berichtete (Lentine & Tali, 2020). Die Grundrechte wurden weiter eingeschränkt, drakonische Formen der Überwachung und Unterdrückung durchgesetzt, gezielt polarisierende Rhetorikstrategien ergriffen und inkohärente Führungsansätze mit Angriffen auf die Stimmen und Meinungen von kritischer Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Bürger*innen vertuscht.
Die Pandemiepolitik bedeutete, das autoritäre Chaos strategisch zu managen und zu navigieren. Dabei griff die Präsidialregierung auf eine Art kalkulierte Strategielosigkeit zurück. Ein Interviewpartner bringt das wie folgt zum Ausdruck: „Die Regierung versucht, eine Reihe von Missständen und Unzulänglichkeiten zu vertuschen, die die Pandemie unregierbar gemacht haben.“ Aydin, ein Datenaktivist, kritisiert, wie „Saray [der Palast, eine Metapher für das Präsidialsystem] alles [nutzt], um die alltägliche Verwahrlosung, Gleichgültigkeit (kayıtsızlık) und fehlende Strategien (strateji yoksunluğu) als ein Zeichen seiner Stärke zu verpacken“. Eine strikte Pandemiepolitik fehlte, ebenso eine transparente Informationspolitik. Mehrere Gesprächspartner*innen nannten „Belege“ hierfür, wie folgt: „einseitige Entscheidungsbefugnisse“, „geschwächte Institutionen“, „schwache Autonomie und Mündigkeit“, „manipulative Kontrolle über die Medien, Behörden und Kommunikationsmittel“, „verstärkte Überwachung von allem und jedem“, „eine unkalkulierbare Politik, die nur darauf ausgelegt ist, die Macht des Palasts zu inszenieren“. Solche Äußerungen verdeutlichen nicht nur Zweifel an der krisenpolitischen Kompetenz der Präsidialregierung. Sie zeigen vielmehr, wie die Regierungsfähigkeit entlang der Achse von Zentralisierung und Dezentralisierung in Frage gestellt wurde. Die Türkische Ärztekammer (TTB) führte mehrfach bei öffentlichen Veranstaltungen, an denen ich teilnahm, Zahlen und Daten an, die das Ausmaß der pandemischen Missstände deutlich machten. Die Regierung ignoriere sie und missachte die kritische Expertise. Berichtet wurde über eine teilweise große Kluft zwischen den HES-Daten und registrierten sowie bewerteten „Daten aus dem Feld“. Ein „Wahrnehmungsmanagement“ wurde der Regierung attestiert, mit der Intention, das „Versagen“ im Zuge der Epidemie als „Erfolgsgeschichte“ zu präsentieren. All dies steht dafür, wie die Pandemie in dem Land auf autoritäre Datenpolitiken trifft.
3.2 Virale Spurenverfolgung und Politiken von Daten
Das HES ist ein digital gesteuertes Kontakttracking- und Proximity-System mit einer Applikation. Auf der zugehörigen App führt mich meine Gesprächspartnerin Beyza durch die virtuellen Echtzeit-Maps des Covid-19-Virus in Istanbul. Diese bilden die virale Ausbreitung ab. Darauf kann sie jederzeit mit ihrem Smartphone zugreifen, genauso wie alle anderen, die die App auf ihren mobilen Geräten installiert haben. Sie kann damit durch den pandemischen Alltag navigieren, sagt sie, während sie in die Maps hinein und aus ihnen heraus zoomt. Sie führt mir vor, wie HES die virale Datenlage visuell und numerisch darstellt. Mal wirft sie aus der Vogelperspektive einen Blick auf das ganze Land, mal zoomt sie in die Risiko- und Sicherheitsregionen, die auf der Karte in Rot, Grün und Gelb markiert sind. Seit April 2020 ist die App dem Virus auf den Fersen, erzählt Beyza. Dabei generiert sie nicht nur Daten zu Covid-19 und „Kontaktketten“. Darüber hinaus werden „ununterbrochen, in Echtzeit und von der Gesamtbevölkerung“ via HES-Kodu individuelle Gesundheits- und Bewegungsdaten erfasst. Sie kann zwar selbst entscheiden, ob sie die HES-App auf ihrem Smartphone nutzen möchte. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist sie allerdings nicht imstande, der Teilhabe an dem Tracking- und Proximity-System auszuweichen. Alle Bürger*innen und alle, die ins Land einreisen und sich im Land aufhalten, müssen einen individuellen QR-Code mit sich führen. Der obligatorische Code wird bei Behördengängen, Reisen und an öffentlichen Plätzen wie Einkaufszentren digital abgelesen. Bei der Erstellung ihres Codes musste Beyza ihre Ausweisnummer (T.C. kimlik numarası)8 angeben. Dadurch werden ihre Daten an die zentralen Dateninfrastrukturen der e-Devlet, der sogenannten e-Staat übermittelt, unter anderen an e-Nabız (e-Puls), das digitale System der Datenvermittlung und -überwachung im Gesundheitswesen.
Beyza arbeitet im öffentlichen Dienst, und nach dem Einbruch der Pandemie wurde sie zeitweise in ein Proximity-Team des HES einbezogen. Als links und säkular eingestellte Dissidentin sieht sich die 40-Jährige mit einer unverhältnismäßig ausgedehnten Staats- und Überwachungsmacht konfrontiert. Was einige mit effektiver Pandemiebekämpfung oder Bequemlichkeit assoziieren, ruft bei ihr ein „mulmiges Gefühl“ hervor:
Corona-Kontaktverfolgung ist natürlich sehr wichtig, keine Frage; wir brauchen natürlich mehr Daten, aber unter den politischen Bedingungen dieses Landes fühlt dies [die Überwachung] sich wie ein autoritärer Alptraum an ... Es gibt diesen digitalen Hype der datenhungrigen Regierung, weißt du, die eine riesige Datenmaschinerie [gebaut hat], aus der wir kaum noch herausfinden und herauskommen. Nun, diese HES; niemand kann sich bewegen, ohne den HES-Code zu scannen, [und] das produziert eine immense Menge an Daten über die Standorte der Menschen, ihre Bewegungen, ihren Gesundheitszustand, Impfstoffe und so weiter, aber man weiß nicht wirklich, wofür ... Was passiert, wenn diese Maschinerie alle Schritte und Tritte von jedem Bürger registriert?
HES und die damit einhergehenden Datenpraktiken beförderten die Vorstellungen von einem Überwachungsstaat und einem dahinterstehenden panoptischen Prinzip (Foucault, 1977, 2005). Besonders zu Beginn ging es Hand in Hand mit den tyrannischen und hyperpolitischen Ansprüchen der Präsidialregierung, dem oft die Intention zugeschrieben wird, „allwissend über alle Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens zu sein“ (Topak, 2014, S. 539). Äußern meine Gesprächspartner*innen wie Beyza Ängste und Sorgen, so geht es ihnen um ein undurchsichtiges Konglomerat von digital-kapitalistischen Überwachungslogiken und einem autoritären Duktus.
HES fungierte als eine „soziotechnische Assemblage“ (Liu & Graham, 2021), denn es koppelte Viren, Körper, Bewegungs- und Personendaten, Smartphones, QR-Codes, Algorithmen, Technologieunternehmen, Gesundheits- und Verwaltungskräfte aneinander. Die Pandemieüberwachung und das Datenmanagement wurden dadurch größtenteils „appifiziert“ (Datta, 2020). Mithilfe von Handys und HES-Kodu ließen sich Personen-, Gesundheits- und Bewegungsdaten generieren, überprüfen und auswerten. Auf zwei Wegen generiert(e) HES Daten: zum einen via „Datenspende“, das heißt eine freiwillige Eingabe von individuellen Daten, und zum anderen durch das obligatorische Einscannen der HES-Codes. Zudem wurden Daten über Denunziationen generiert. In die HES-App war die Rubrik ihbar integriert, über die Menschen Fälle von Verletzungen der Maßnahmenbestimmungen denunzieren konnten. Für diese Art von Datenarbeit wurden die Datenschutzregelungen an die außergewöhnlichen Bedingungen angepasst. Ähnlich wie in vielen anderen Ländern, ob autoritär oder demokratisch regiert, setzten die Pandemieregelungen die bestehenden Datenschutzgesetze und -grundsätze außer Kraft. Der Echtzeit-Zugriff des Staats auf Personen- und Bewegungsdaten via GPS, QR-Codes und Bluetooth wurde ausgeweitet, was weit über das zuvor in der Türkei und vielen Ländern gültige rechtliche Maß hinausging. HES generierte Meta-Daten zum viralen Geschehen. Seine Funktion ging über die virale Überwachung hinaus. Es kam zum Einsatz, um die Pandemie mithilfe von digitalen und algorithmischen Verfahren nachvollziehbar zu machen, Risiken zu berechnen, Viralität zu kalkulieren und die Städte viral zu kartografieren. Die obigen drei Bilder (Abbildung 2) sind „Schnappschüsse“ aus diesen viralen Landschaften. Sie zeigen die virale (Daten-)Lage Istanbuls in einem kurzen Augenblick. Diese Virus-Maps oder viralen Maps, wie sie damals oft bezeichnet wurden, änderten sich stets visuell, virtuell und digital. Während sie für einige mehr virale Sicherheit bedeuteten, brachten sie für andere virale Ausgrenzung und Unfreiheit mit sich. Sie simulierten via Überwachung (flüchtige) Beziehungen zwischen infizierten Menschen und verseuchten Räumen, und zwar auf der Grundlage von Privilegien wie der Privatsphäre und Datenschutzpolitiken (D’Ignazio & F. Klein, 2020; Milan et al., 2021; Zurawski, 2020). Dargestellt wurden datenbasierte Realitäten, wobei nicht klar war, auf welche Daten sie zurückgriffen und wie gut sie die menschlichen und viralen Mobilitätsmuster abbildeten.
In den letzten drei Machtphasen der AKP führte die Digitalisierung in fast allen Bereichen der Staats-, Stadt-, und Bürger*innenangelegenheiten zu einer Zentralisierung des Verwaltungs- und Staatsapparats. Damit ging die Datafizierung von Gesundheits-, Sicherheits- und Bürokratie-Infrastrukturen einher, besonders durch E-Staat (e-devlet) und E-Puls (e-Nabiz), woran auch HES gekoppelt ist. Der E-Staat als Dateninfrastruktur ermöglicht zwar eine intensive Datenarbeit und treibt die Datafizierung in den besagten Bereichen des soziopolitischen Lebens im Land voran, dennoch ist die Datafizierung durch selektive Datenarbeit, systematische Mängel im System und institutionelle Unzulänglichkeiten geprägt (Saluk, 2022). An den digitalen Datensystemen wie dem Gesundheitsdatensystem E-Puls können die Menschen analog teilnehmen. Zugleich besteht kaum eine Möglichkeit der Verweigerung des Einspeisens persönlicher und gesundheitlicher Daten in diese Systeme. Andernfalls wären sie aus dem staatlichen Sektor ausgeschlossen. Ihre Daten werden über ihre individuelle ID-Nummer an das System übermittelt. Während der Pandemie koppelte das HES-System einen QR-Code an die ID-Nummern und überbrückte so die Kluft zwischen digitaler und analoger Nutzung des Systems. Die Nutzung der App war somit für einzelne Personen nicht verpflichtend. Solange sie ihren QR-Code bei sich trugen, beteiligten sie sich an der Datenarbeit. Bürger*innen mussten in der Zeit meiner Forschung ihre QR-Codes zum Beispiel bei Behördengängen, am Arbeitsplatz, in Einkaufszentren, an öffentlichen Orten oder vor Reisen vorlegen. Durch das Einscannen individueller QR-Codes konnten Standort- und Gesundheitsdaten ermittelt und an e-Systeme übermittelt werden. Auch private und institutionelle Akteur*innen waren imstande, auf anonymisierte Daten zuzugreifen und zum Beispiel den Gesundheitsstand einer Person abzufragen.
HES war täglich bei filyasyon ekipleri, den sogenannten Proximity-Teams, im Einsatz. Dadurch spürten sie jenen temaslı (Kontaktpersonen) nach, denen ein hohes Risiko der Begegnung mit einer Corona-positiven Person attestiert wurde, und registrierten sie über die HES-App. Zu Beginn meiner Forschung war für mich schwer nachvollziehbar, wie HES in den Alltag integriert wurde. In den Medien wurden die Nutzenden als Corona-Detektive inszeniert, die Jagd auf Corona machten. Im Rahmen von Gesprächen und in den sozialen Medien fanden sich Verweise auf eine bürokrasi filyasyon zinciri, eine bürokratische Proximity-Kette. Diese bestand aus Gesundheitspersonal, lokalen Verwaltungen, der Polizei und Wächtern (mahalle bekçisi), Imamen und ebenso aus neu errichteten Versorgungsanstalten wie den sogenannten Corona-Heimen, in denen damals positiv getestete Personen für eine 14-tägige Quarantäne untergebracht wurden. Zu dieser Kette gehörte HES als Werkzeug und digitale Dateninfrastruktur. Die Appifizierung der Pandemieüberwachung ermöglichte eine breitere und schnellere Kontrolle sowie Datenerfassung. Oft wurde HES und ähnlichen Technologien eine Kapazität für die Erstellung einer lückenlosen Datenlage zugeschrieben. Bei vielen, ob regimekritisch oder -nah, löste HES Unbehagen aus. Einige sahen darin eine Erweiterung der auf Überwachung und Kontrolle gerichteten Digitalisierung staatlicher und bürokratischer Verfahren. In einem informellen Gespräch hieß es zugespitzt, dass der Staat „alles, was Bürger*innen tun, registriert und beliebig auf diese Informationen zurückgreifen“ kann. Solche Ängste wurden auch durch die Erweiterungspläne der Regierung geschürt. Der damalige Gesundheitsminister Dr. Suayip Birinci kündigte beispielsweise mehrfach an, dass HES um elektronische Armbänder, Sprach- und Gesichtserkennung erweitert werden sollte. Innerhalb eines kurzen Zeitraums kam es zu einer großen Menge von Posts und Meldungen dazu. Verschiedene Gruppierungen organisierten sich über soziale Medien. Auf den Straßen von Istanbul und anderen Großstädten fanden Protestaktionen mit geringer Reichweite statt. Die auf Twitter präsenten Videos von diesen Protesten erreichten eine größere Reichweite und stießen auf Anerkennung. Diese rekurrierten auf die damals beinah global verbreiteten Rhetoriken und Diskurse, basierend auf einer Mischung von sogenannten Corona-Gegner*innen, Verschwörungstheorien und teils berechtigten Sorgen und Belangen. Ähnlich wie anderswo war das türkischsprachige Twitter dominiert von Verschwörungserzählungen über die Inszenierung der Pandemie, um eine digitale Machtübernahme und Wende anzubahnen und zu legitimieren.
Eine Gruppe, die sich Bağımsız İslami Hareket (Unabhängige Islamische Bewegung) nannte, plakatierte die Straßen mit Hinweisen zu „digitaler Diktatur (dijital diktatörlük)“, „digitale[m] Faschismus (dijital faşizm)“ oder „digitaler Sklaverei (dijital kölelik)“ (Abbildung 4). Sie rief zugleich zum „Aufwachen“ auf. Ihre Narrative beziehen sich auf dystopische Vorstellungen und Diskurse zu digitalen Technologien und Überwachungsmaßnahmen. Eine detaillierte Analyse der Bewegung würde den Rahmen dieses Artikels überschreiten. Zu erwähnen ist allerdings, dass viele der beteiligten Personen digitale Datentechnologien als eine ernst zu nehmende Gefahr wahrnehmen. Ohne diese digitale Protestszene auf eine Ansammlung von Verschwörungstheoretiker*innen reduzieren zu wollen, ist festzustellen, dass zahlreiche Tweets auf die Diskurse und Vorstellungen von „einem globalen Plan bestimmter globaler Mächte“ rekurrieren, die scheinbar einen Abbau der Demokratie bis zu einer digitalen Diktatur heraufbeschwören. Der Neologismus Plandemi (Plan/Pandemie) zirkulierte, nicht selten mit Rekurs auf Aussagen wie „Gegen Tech-Giganten wie Bill Gates, die ihre eigene digitale Diktatur aufbauen“ und „Gates wird alle mit Chips impfen“. Diese Diskurse markieren den Flirt und den Zusammenschluss von Regierungen, digitalen Firmen sowie Tech-Giganten und antizipieren, dass diese Annäherungen überhandnehmen können, wenn die Digitalisierung weiter vorangetrieben wird. Viele meiner Gesprächspartner*innen distanzierten sich davon. In langen Gesprächen beriefen sie sich bewusst auf andere Referenzpunkte und ein anderes Vokabular. Im Falle von Ähnlichkeiten klärten sie mich schnell über die Differenzen auf. Sie stellten immer wieder ihre moralischen, emotionalen und politischen Ansprüche klar, wenn sie auf einen Staat-Markt-Komplex hinwiesen, vor dessen Folgen sie sich fürchten. Eine Interviewpartnerin sprach von einem „Regime der Angst“ (korku rejimi), das sich durch ein Zusammenkommen der Pandemie mit intensiver Digitalisierung und Überwachung sowie einer Verfestigung autoritärer Strukturen verschärfen könnte: „[Gegenüber der Regierung] laut werden ist für uns seit einer Weile kein Thema mehr, das kennst du ja. Wir konnten sowieso keinen Mucks von uns geben. Noch dazu stecken wir nun (nach der Pandemie) fest, können uns nicht mehr bewegen. Es ist kein Wahn, aber es fühlt sich so an, als ob alles Augen und Ohren hätte. In unseren vier Wänden ... wo wir nun fast alles online machen.“ Für andere bedeutete es Willkür und Undurchsichtigkeit im Umgang mit Daten.
HES als ein komplexes, soziotechnisches Ensemble funktionierte allerdings nicht reibungslos. Es verlangte aktives Mitmachen, sozio-technische Kapazitäten, funktionierende staatliche Institutionen und digitale Dateninfrastrukturen. Von den einzelnen Bürger*innen brauchte es ein Mindestmaß an Vertrauen sowohl in die staatlichen Institutionen als auch in die technischen Lösungsansätze, die bei den Krisen eingesetzt werden. Noch im Jahr 2020, während die pandemischen Maßnahmen sehr streng waren, berichteten mir viele Gesprächspartner*innen von Systemfehlern. Insbesondere die HES-App, so die Expert*innen, wurde nicht so effektiv genutzt, wie es für die Eindämmung der Pandemie von Vorteil gewesen wäre. Ein Datenexperte sieht „ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber dem Staat“ als einen Faktor an: „Die Menschen trauen ihrer Regierung und ihren Absichten bei der Entwicklung dieser Technologie nicht; sie trauen nicht, wo ihre Daten verwendet werden.“ Zum Beispiel nutzen viele Menschen Screenshots von QR-Codes anstelle der App, „weil sie denken, dass sie nicht überwacht oder verfolgt werden, während sie mit einem QR-Code überall hingehen können, wo sie wollen“.
Als ich im Jahr 2021 im Land war, hatte ich ein ähnliches Bild davon, wie HES funktionierte. Vor meiner Einreise musste ich einen HES-Kodu beantragen, wie alle anderen Einreisenden mit Fremdpässen, und einen Wohnort beziehungsweise eine Reiseroute mit Adressen angeben. An großen Treffpunkten wie Flughäfen und Einkaufszentren wurde der HES-Kodu eingescannt. Im Rahmen von Polizeikontrollen, die im Land seit dem Putsch-Versuch im Jahr 2016 gefühlt alle paar hundert Meter stattfanden, wurde neben GBT (Genel Bilgi Toplama, zu Deutsch: Überprüfung des Strafregisters) auch der HES-Kodu kontrolliert. Einiges passte nicht zu den Narrativen und Diskursen über ununterbrochene Überwachung und lückenlose Datenarbeit. Es stand eher auch im Widerspruch zu vielen kritischen und befürwortenden Darstellungen, die im Netz kursierten und verbreitet wurden. Sowohl mein Smartphone als auch meinen QR-Code musste ich kaum herausholen, wenn ich mit meiner Familie unterwegs war. Oft wurden wir gefragt, ob wir zusammengehören. In Behörden oder Privaträumen reichte ein QR-Code. Solche Situationen verdeutlichen, dass die Überwachung weder individualisiert noch lückenlos vollzogen wird. Es gibt kleine oder große Umgehungen im Alltag. Im Gegensatz zu idealtypischen Vorstellungen kommen Datentechnologien kaum allumfassend, gleichmäßig verteilt und zuverlässig zum Einsatz. Die Nutzung hängt, wie Erikson (2018) in ihrer Forschung zur Überwachung und Datafizierung bei der Ebola-Krise in Sierra Leone zeigt, davon ab, ob Geräte und Daten als individuelle Gegenstände und Werte gesehen und wie sie von Menschen und Institutionen lokal eingebunden und gehandhabt werden.
Digitalisierte Spurenfolge und Datenerfassung per QR-Codes, Smartphones und Apps dieser Art prägten den Umgang sowohl mit viralen Daten als auch mit der Pandemiepolitik. Ähnlich wie in anderen Kontexten, in denen diese Datentechnologien zum Stillen des Bedarfs an Echtzeit-Daten zum Einsatz kamen, mobilisierte HES die oft undurchsichtigen Geflechte von Regierungsstilen und Politik, Infrastrukturen und (infra-)strukturellen Vor- und Nachteilen, sozio-technischen Antizipationen und Vorstellungen sowie auch Datenpolitiken. Als ein solches System war HES für viele undurchschaubar. Es blieb auch in Bezug auf seine Arbeitsweise und die Reichweite seiner Datenarbeit umstritten, wie ich im Folgenden zeigen werde.
3.3 Ensemble des Unregierbar-Machens
Zahlen, Daten und Mappings ermöglichen, „eine Situation zu modellieren, zu verstehen, zu verwalten und zu beheben, während sie sich entfaltet“ (Kitchin, 2014, S. 181). Sie zerlegen die Situation in quantifizierbare Teile. „Inmitten der Ungewissheit so vieler Unbekannter“ (Lozano, 2020) suggerieren sie Macht, Kontrolle und Transparenz. Oft besteht die Annahme, dass die Verfügbarkeit von Daten uns befähigt, Risiken zu identifizieren, Herausforderungen zu bewältigen sowie Wissen zu generieren, um rationale, politisch vertretbare Strategien zu antizipieren und umzusetzen. In meinen Gesprächen trat ein anderes Motiv hervor: Intention. „Intention (niyet) ist ein Schlüsselwort“, so konstatierte der 40-jährige Osman bei unserem virtuellen Durchgang durch Istanbul auf der Corona-Map. Die Präsidialregierung mache nichts anderes, als sich an die globalen Trends zur digitalisierten Überwachung und Datafizierung der Gesundheit, der Verwaltung und der Sicherheit anzuschließen. Unklar war, „was sie [mit den Daten] machen“. Er fuhr fort: „Welche Daten generiert eine Regierung, welche nicht? Welche Datensätze werden miteinander verknüpft? Das sind Fragen, die wir, also auch insbesondere die Regierung, in der Pandemie stellen sollten. Über die lokalen Verwaltungen, zum Beispiel ‚Smart City‘-Projekte, stehen uns bereits seit Jahren Datensätze zur Verfügung, die die Regierung in der Pandemiepolitik einsetzen könnte. Getan haben sie mit diesen Daten aber nichts“. Stattdessen trennte die Regierung Datensätze. Die Datenarbeit ist auf Zählungen reduziert. Zudem weiß die Öffentlichkeit nicht, auf welche Daten das System zurückgreift, welche Datensätze bei solchen Visualisierungen viraler Situationen zum Einsatz kommen und welche Daten aussortiert werden.
Während der unterschiedlichen Wellen der Pandemie blieb Datenmacht das Motto des Pandemiemanagements. Die Präsidialregierung hatte sie als einen Kampf mit und gegen Zahlen kodiert. Wiederholt wurde betont, dass „Daten zum Auslöser für viel größere politische Veränderungen“9 gemacht werden sollten. Transparenz wurde als Voraussetzung beziehungsweise Schlüsselkompetenz dafür dargestellt. Die Regierung behauptete, eine konsequente Politik zu betreiben, die auf digitaler Erfassung, Vermittlung und Nutzung von Echtzeit-Daten basiert, doch gab es kaum Anzeichen dafür, dass die Pandemiepolitiken wie propagiert auf Meta-Daten und Tief-Daten (derin veri) basieren. Weder die Maßnahmen noch die damaligen Sperrungen waren datengesteuert. Die Entscheidungen wurden meistens zentral getroffen, und zwar nicht vom Gesundheitsministerium, sondern von Präsident Erdoğan. Menschen, mit denen ich damals Kontakt hatte, bemängelten die intransparente und inkonsequente Politik. Eine doppelbödige Strategie der Präsidialregierung wurde deutlich. Diese ähnelte dem, was Mason (2016) für die Ereignisse der SARS-Epidemie von 2003 in China beschreibt: „[p]erformative Hypertransparenz“ eines dramatisierten Kampfes gegen die Krankheit und „technologisierte Hypertransparenz“ des Datenaustauschs über die Krankheitsinzidenzen zwischen lokalen und nationalen Gesundheitsbehörden. HES diente zur Performanz einer technologisierten Hyper-Macht über Daten. Eine Gesprächspartnerin beklagte „eine Maxime der Pseudo-Politik (miş gibi) natürlich wie immer mit einer Überdosis an unberechenbarer Haltung“. Auf Twitter rekurrierten folgende Meinungen: „Smartphones und technologische Lösungen werden uns nur als Vorwand und Erfolgsmodell gegen die gescheiterte Pandemiepolitik der Regierung aufgetischt.“ In einem anderen Tweet wird geäußert: „Ich logge mich in die Hayat Eve Sığar App ein, schaue mir die Risikoregionen in Istanbul an. Fast alle Ecken der Stadt sind rot. Und guckt man sich die [verkündeten] Zahlen im Land an: Dreitausend-irgendwas“. Die Datenarbeit in Echtzeit schwankt für sie zwischen „Hype und Rummel“.
Während ich diesen Artikel redigiere, wird in der Türkei, wie überall, die Pandemie als unter Kontrolle betrachtet. Die Maßnahmen wurden aufgehoben. Datenüberwachung und -verfolgung durch HES gingen deutlich zurück. Der Gehalt an Informationen zur Pandemie wurde dünner. Zahlreiche Berichte decken die fehlende Transparenz und Datenmanipulation im Land auf. Ein unabhängiges Forschungsinstitut, Total Analysis, positionierte die Türkei in Bezug auf „Transparenz und Bereitstellung genauer Informationen durch staatliche Institutionen und Einzelpersonen“ während der Pandemie auf dem vierten Platz von 99 Ländern. Mit 18,7 Punkten konnte die Türkei fast mit Ländern wie China, Nordkorea und Turkmenistan mithalten, die als „strengste diktatorische Regime[s] der Welt“ gelten.10 Dies stimmt mit Meinungen und Erfahrungen von vielen Menschen überein, mit denen ich zu tun hatte. Sie bezeichneten das Pandemie-Management entweder als „á la Turca“ (türk usulü) oder als „á la Palas“ (Saray tarzı pandemi yönetimi). Darunter verstehen sie das Vorgehen einer unkundigen und manipulativen Regierung. Deutlich wurde für sie, wie täuschend das Bild des allumfassenden Staats ist, beziehungsweise wie fragmentarisch seine Macht wirkt. In einem publizierten Interview sagt Arıkan: „Dass der Staat alles sieht ist eine Illusion. Im Gegenteil: Es gibt Daten, die der Staat nicht sehen möchte; die Ignoranz ist an sich eine autoritäre Politik.“ (vgl. Odman, 2019) Ein Datenexperte, mit dem ich über diese datenkritische Perspektive sprach, sagte: „Das ist längst bekannt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Blick auf etwas und dem tatsächlichen Sehen. Der Staat überwacht die ganze Zeit, aber er sieht nur das, was er sehen und sehen lassen will. Die Tatsache, dass Daten existieren, bedeutet nicht automatisch, dass sie für Staat, Institutionen und Politik zugänglich sind.“
Mein Interviewpartner Mehmet schilderte in zugespitzter Form: „Sie sehen, was sie sehen wollen, und sie liefern die Daten so, wie sie wollen, dass wir sie sehen.“ Bei der Datenarbeit ist ein „mächtiges Wirrwarr am Werk“, so entnehme ich es meinem Gedächtnisprotokoll zu dem Gespräch, bei dem er mir eine Aufnahme nicht zugestand. Als Datenexperte beobachtete er im Fall von HES, dass Daten sich von Transparenz und Rechenschaftspflicht lösen. In den komplexen „Data Worlds“, wie er auf Englisch sagt, geht es immer um politisch höchst aufgeladene Prozesse, die Daten und Datensouveränität zu einem Problem der Bürger*innen machen. In Ländern wie der Türkei, die eine autoritäre Zentralisierung vorantreiben und diese auf den Privatsektor ausweiten, komme noch eine „autokratische Staatsstruktur“ dazu. Diese lege digitale Politik „in die Hände von einigen Machthabern (muktedirler)“. „Die Datenarbeit wird auf reine Datenerhebung reduziert“, fährt er fort. Im Gegensatz zu Darstellungen der Präsidialregierung herrscht „eine autokratische und konservative Haltung im Umgang mit Daten“. Eine „tragbare Kultur für Datenaustausch zwischen den Institutionen“ ist nicht vorhanden. Aus seiner Sicht wurde das „Recht auf Daten als demokratisches Recht“ bisher nicht angemessen anerkannt. Mehmet argumentiert, dass Daten kaum ein politisches Mittel für Bürger*innen darstellen, „weil sie keinen Zugang zu Daten haben“. Die Initiativen, die sich gegen eine autokratische und konservative Haltung des Staats in Sachen Daten organisieren, weisen auf Missbrauch und manipulative Methoden der Datennutzung hin. Ebenso wie von anderen Gesprächspartner*innen wird allerdings auf einen Mangel an tragfähigen Beweisen hingewiesen. Staatliche Daten(infrastrukturen) und -praktiken sind demnach weit entfernt von Rechenschaftspflicht, Transparenz und Zugänglichkeit. Es gilt als schwierig, entsprechende Maßnahmen einzufordern. Laut einigen Interviewpartner*innen liefen diesbezügliche Forderungen häufig ins Leere, denn die Präsidialregierung ist nicht bereit, Informationen über die technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte des Aufbaus von Dateninfrastrukturen preiszugeben.
In meinem Feld hörte oder las ich im Netz oft Kritik an „autoritären Manipulationen an Zahlen“. Um das „Versagen“ im Zuge der Pandemie zu kaschieren, so die Kritik, setzte die Präsidialregierung strategisch auf „Wahrnehmungsmanagement“ und aggressive Intransparenz gesetzt. Sie betreibe eine „kalkulierte“ und „fahrlässige Politik mit Daten und Zahlen, auf Kosten Abertausender Leben“. Obwohl die Türkei von der Präsidialregierung als „das beste Land der Welt für virales Proximity-Tracking“ angepriesen wird, sehen die Menschen in der Nutzung von Daten eine Art Covidifizierung des ungeschickten, manipulativen und arroganten Vorgehens einer autoritären Regierung und ihrer hyperpolitischen Selbstheroisierungs- und Leugnungsstrategien. Oft erkennen sie auch die zunehmende Unberechenbarkeit als eine Regierungsstrategie. Das folgende Zitat aus einem informellen Gespräch bringt das tiefgreifende Misstrauen zur Sprache: „Du kannst nie wissen, welche Daten sie [die Regierung] servieren und welches Chaos sie hinter diesen Zahlen verstecken“. Eine andere Gesprächspartnerin kann das gut nachvollziehen. „Wir verstehen das System nicht mehr. Wir trauen den Daten nicht, weil es keine Transparenz gibt“, sagt sie. In einem zynischen und spöttischen Ton fügt sie hinzu: „Ich traue nicht mal ihren Daten über die Inflationsraten – soll ich jetzt ihren Todeszahlen trauen?“
Die Pandemie führte das Bedürfnis der Gesellschaft nach einem funktionierenden und verlässlichen Staat vor Augen. Dabei geht es weniger darum, dass der Staat via Datensystemen und Apps alle Schritte überwacht und lückenlose Metadaten über die virale Lage erstellt, sondern in Anlehnung an Rob Kitchin um „Fragen der ordnungsgemäßen Verfahren und der Rechenschaftspflicht (bürokratische Gleichgültigkeit, Fehler, Missbräuche, Frustration, mangelnde Transparenz und Regressansprüche)“ (Kitchin, 2014, S. 180). Erstaunlicherweise stimmt das mit den Ansichten und Empfindungen meiner Gesprächspartner*innen überein, wenn sie über Daten und Macht in ihrem Land reden. Viele betonen explizit oder implizit, dass die Messlatte des Ordnungsgemäßen über die Jahre tiefer gesetzt wurde. Unter dem Hashtag #Yönetemiyorsunuz (#ihrkönntnichtsteuern/regieren) klagten viele über autoritäres Handeln basierend auf einer unsicheren Datenlage. Darunter rekurrierten unzählige Posts, Bilder, Videos, Inhalte und kritische Meinungen, denen zufolge „technologische Lösungen [...] als Vorwand und Erfolgsmodell gegen die gescheiterte Pandemiepolitik aufgetischt“ wurden. Sie artikulierten, dass die Regierung „mit unvollständigen und falschen Daten“ gehandelt und dadurch „die Pandemie unregierbar gemacht“ hatte. Oft wurde mir erklärt, dass das Pandemiemanagement nicht auf allen verfügbaren Daten basiert. Eher setzt es demnach gezielt auf verzerrte Daten, die kritische Datenaktivist*innen im Land als parteiische Daten (yanlı veriler) begreifen. Sie sind parteiisch, weil sie so operationalisiert werden. Odman & Tülek (2021) stellen in ihrem Bericht für die TTB (Türkische Ärztekammer) fest, dass HES „disaggregierte Daten (ayrıştırılmamış/paçal veriler)“ produziert. Diese umfassen die Anzahl der Fälle einschließlich der Genesenen und Toten. Eine detaillierte Auswertung nach verschiedenen Verwaltungsebenen wie Regionen, Provinzen, Bezirken und Stadtteilen oder beispielsweise nach Geschlecht, Alter, Einkommensgruppen, Berufsgruppen/Sektoren, Bildungsniveau, Begleiterkrankungen, Symptomen und Risikogruppen erfolge jedoch nicht.
Aus diesen Überlegungen gingen alternative Datenprojekte hervor, die sich mit staatlicher und halbstaatlicher Datenmacht auseinandersetzen. Diese markierten nicht nur Datenlücken und Scheinpolitiken mit Daten, mit falschen und mangelhaften Daten. Explizit und implizit machten sie auf die intransparenten und unberechenbaren Politiken mit Daten aufmerksam gemacht; diese wurden mit eigenen Daten offengelegt. Darüber hinaus nutzten sie die Daten von HES, um andere Datenrealitäten zu erzählen beziehungsweise das virale Geschehen auf die soziopolitischen Differenzen hin zu datafizieren. Obgleich noch geringfügig, entwickelte sich doch eine alternative Datenarbeit. Diese kann zu den neuen aktivistischen und antizipatorischen Formen von Gegendaten gezählt werden, die gerade die hegemonialen Datenpolitiken in Frage stellen, indem sie Daten als Werkzeug und Repertoire in ihrer Widersprüchlichkeit anwenden (Beraldo & Milan, 2019). Das Projekt Kent95 ist ein Beispiel dafür. Hier wurden die öffentlich verfügbaren HES-Daten und eigene Daten zum sozialräumlichen Profil von Istanbul aufeinander bezogen. Das Resultat bildet eine interaktive Landkarte, welche die Verbreitung und Verteilung der Pandemie-Zahlen entlang von sozio-ökonomischem Status und Benachteiligungen nachzeichnete (Abbildung 5; vgl. Odman & Tülek, 2021). Ein weiteres Beispiel dafür kommt von einer Gruppe aus kritischen Expert*innen der TTB, der türkischen Ärztekammer, die eine intensive Datenarbeit im Kontext von Pandemieüberwachung und -management leistete. Diese Expert*innen bekundeten Datenmängel und die damit einhergehenden Missstände des autoritären Pandemie-Managements. In diversen Veranstaltungen, zu denen ich mich zuschalten konnte, etwa „Covid-19-Pandemie im Rückblick auf das erste Jahr“11 von der TTB, trat die Komplexität datenbezogener Machtkämpfe deutlich zum Vorschein. Die Expert*innen betonten nachdrücklich „die Relevanz von Datentransparenz (veri şeffaflığı)“. Sie forderten eine offene und nichtmanipulative Politik mit Daten. Dabei demonstrierten sie zugleich, dass die Verstärkung der Verfolgung von viralen Spuren, das heißt das digitalisierte Sammeln von mehr und mehr viralen Daten, nicht zwangsläufig handlungsfähige und gerechtere Datenpolitiken zufolge hat beziehungsweise haben kann (D’Ignazio & F. Klein, 2020; Leszczynski & Zook, 2020; Polat, 2020a). Diese Wahrnehmungen decken sich bemerkenswerterweise mit Diagnosen der kritischen Datenstudien und Datenanthropologie. Sie knüpfen an Kritik und Widerstände gegen die fortbestehende digitale und datafizierte Regierungsmacht an. Dabei spiegeln sie die Tatsache wider, dass der Staat stets eine prekäre Macht über Daten performt. Zugleich markieren sie, wie Daten nicht nur, aber ganz besonders in autoritären Geflechten zu einem politischen Feld werden.
4 Schluss
Im Rückblick auf die vergangenen drei Jahre, seitdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zur Pandemie erklärte, sind deutliche Veränderungen im Umgang mit Daten festzustellen. Sie wurden maßgeblich durch Tracking- und Datentechnologien beeinflusst. Deren breite Anwendung zur Verfolgung der Virulenz des Virus führte zur Entstehung komplexer Datenlandschaften. In diesem Artikel setzte ich mich mit diesen Landschaften in der Türkei auseinander – mit Fokus auf das datenpolitische Element im Hinblick auf autoritäre Strukturen. Die Frage der (Un-)Regierbarkeit während der Pandemie wurde in diesem Kontext als eine Frage der Datenpolitiken verstanden, verhandelt und herausgefordert. Anstelle biopolitischer Verschiebungen, die mit staatlicher Überwachung, Regulierung und Quantifizierung einhergehen, analysierte ich vor diesem Hintergrund die Veränderungen und Herausforderungen im Bereich der Datenpolitiken. Im Zentrum stand die Frage, wie eine autoritäre Präsidialregierung in dieser global geteilten Pandemiesituation das Datenmanagement betreibt und wie virale Daten sowie entsprechende Technologien eingesetzt werden. Meine Herangehensweise orientierte sich an der sozial- und kulturanthropologischen Forschung im Bereich der Daten. Den Leitfaden bildete ein relationaler Ansatz, der die flexible Verbindung von Daten, Praktiken, Technologien, Infrastrukturen, Machtstrategien, Diskursen und narrativen Elementen sowie soziotechnischen Vorstellungen und Unberechenbarkeiten berücksichtigt.
Ein besonderes Augenmerk lag auf den autoritären Geflechten im Kontext der datenbezogenen Pandemieüberwachung. Ich untersuchte den Einsatz des Tracking- und Datensystems HES und beschrieb, wie die Bevölkerung den Umgang mit Daten unter der autoritären Präsidialregierung erlebte. HES fungierte als ein soziotechnisches Ensemble, das Viren, Menschen, Körper, Bewegungs- und persönliche Daten, Smartphones, QR-Codes, Algorithmen, Datenpraktiken und -infrastrukturen miteinander verknüpfte. Auch sogenannte Proximity-Teams, Gesundheitsexpert*innen, Datenexpert*innen und Verwaltungskräfte wurden in die staatliche Pandemieüberwachung und Datenarbeit einbezogen. Das System ermöglichte eine Echtzeit-Datenerfassung über individuelle QR-Codes, die im Zeitraum meiner Forschung für jede*n Bürger*in verpflichtend waren. Basierend auf der Auswertung dieser Daten wurde die virale Situation kartografiert und für die Öffentlichkeit visualisiert.
Während der Überarbeitung dieses Textes verlangsamte sich die Pandemieüberwachung weltweit, auch in der Türkei. Die einschneidenden Maßnahmen wurden aufgehoben, der Einsatz des HES-Systems wurde eingeschränkt und die obligatorischen QR-Codes befanden sich nicht mehr in Anwendung. HES wurde in die Dateninfrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens integriert, und die zuvor beschriebenen Datenlandschaften existieren nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form. Sie entstanden durch die Verschmelzung von Softwarearchitekturen und Datenerfassungsprozessen, die auf Überwachung und algorithmischer Quantifizierung basieren. Sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Tracking-, Überwachungs- und Datensysteme spielten eine Rolle und wurden von individuellen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Datenpraktiken geprägt. Dies schloss auch Gegen-Daten-Praktiken ein, die den manipulativen, willkürlichen und repressiven Umgang mit (viralen) Daten kennzeichneten. Datenlücken bildeten ein charakteristisches Merkmal dieser Landschaften, ebenso die oft undurchsichtigen Prozesse der Datenerfassung. Die Methoden, die ich anwandte, sowie die Bedingungen während der Pandemie und die politischen Faktoren beeinflussten den ethnographischen Forschungsprozess erheblich.
In zweierlei Hinsicht können die beschriebenen Datenlandschaften als Ergebnis von autoritären Datenpolitiken interpretiert werden. Zum einen waren sie geprägt von einem außergewöhnlichen Modus des Regierens, der für den autoritären Regierungsstil in der Türkei charakteristisch ist. Es wird deutlich, wie sich dieser Regierungsstil etabliert, aber auch seine Schwächen und Limitationen werden aufzeigt. Zum anderen stellen sie Orte und Ergebnisse der Inszenierung von Datenmacht durch die Präsidialregierung dar. Daher waren sie für mich als Anthropologin und für viele meiner Gesprächspartner*innen schwer oder nur teilweise zugänglich. Dennoch spiegeln sie wider, wie die pandemischen Bedingungen die Datenpolitiken der autoritären Präsidialregierung beeinflussten.
In diesem Beitrag wurde die Bewältigung der viralen und (bio-)politischen Situation durch Menschen in hoch prekären Datenlandschaften erläutert. Ähnlich wie in anderen politischen Kontexten, seien es autoritäre oder demokratische, waren die Erfahrungen der Bevölkerung im Umgang mit der Pandemie vielfältig. Es wurde eine Vielzahl von Bedenken geäußert, die sich auf die Ausweitung der digitalen Regierungsmacht und die Überwachung im Zusammenhang mit der Pandemie bezogen. Sie betrafen nicht nur die Überwachung selbst und die damit einhergehende Verletzung der Privatsphäre, sondern reichten, wie von Liu & Graham (2021) für den chinesischen Kontext beschrieben, viel tiefer. Es wurde nach den genauen Methoden der Überwachung, den dahinterstehenden Absichten, den beteiligten Akteur*innen und schließlich der Verwendung der erfassten Daten gefragt. Einige sehen in der aktuellen Lage im Schatten einer unregierbar gemachten Pandemie ein neues Terrain für Machtkämpfe, auf dem Daten und die entsprechenden Technologien zu Werkzeugen autoritärer Regierungsmacht werden. Dabei scheint es weniger um die Digitalisierung viraler Spurenfolge oder deren Integration in Erfolgsgeschichten autoritärer Präsidialregierungen zu gehen. Auch die flächendeckende Überwachung und die damit einhergehende repressive Regulierung scheinen nicht das Hauptproblem zu sein. Vielmehr wird explizit oder implizit auf die Macht der Daten hingewiesen.
Ob es sich um faktische oder inszenierte Macht über Daten handelt, die Pandemie verdeutlichte die Prozesse und Folgen des autoritären Umgangs mit Daten. Darüber hinaus wurden die Verbindungen zwischen autoritärem Regieren, bio- und gesellschaftspolitischen Krisen sowie datenbezogener Überwachung und Quantifizierung sichtbar. In diesem Artikel beschrieb ich die Verbindungen als autoritäre Geflechte und analysierte ihre Auswirkungen auf die Verhandlungen und Auseinandersetzungen im Bereich des Datenpolitischen. Es handelt sich um ein komplexes Gefüge von Technologien, Praktiken, Infrastrukturen, Strategien, Diskursen, Vorstellungen und Widersprüchen. Diese Geflechte passen sich in der besonders herausfordernden Situation der Pandemie flexibel an und üben subtil und schleichend Einfluss auf Machtverhältnisse aus, so mein Argument. Sie bleiben jedoch oft außerhalb von Krisensituationen unsichtbar. Daher müssen sie als Bedingungen (der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten) für Datenpolitiken analysiert werden – sowohl im Kontext des Autoritarismus als auch darüber hinaus. In dem vorliegenden Artikel wird die Entwicklung dieser Geflechte anhand des Beispiels der Türkei nachgezeichnet und eine Verbindung zwischen den Dateninfrastrukturen wie dem türkischen HES sowie den explizit autoritären Politiken in Bezug auf Daten hergestellt. Dabei werden ethnographische Einblicke in die politische Dimension von Daten und deren Technologien in diesen Geflechten geboten. Dieser Artikel trägt somit kritisch zur Analyse von Datenpolitiken in digital geprägten und datenintensiven Gesellschaften bei. Gleichzeitig knüpft er an aktuelle Forschungen an, die Autoritarismus als ein flexibles Phänomen erkunden. Autoritäre Geflechte verdeutlichen, dass Autoritarismus in komplexe soziotechnische Strukturen eingebettet ist, die seine Datenpolitiken prägen. Diese Strukturen treiben datenpolitische Verschiebungen voran und überführen sie in autokratische Machttechnologien.
5 Danksagung
Ich möchte mich bei den anonymen Reviewer*innen für ihre konstruktiven Anmerkungen und Kommentare zu meinem Manuskript bedanken. Mein Dank gilt auch Nils Zurawski für seine freundliche Unterstützung bei der redaktionellen Bearbeitung des Textes sowie Amelie Baumann und Arabella Walter für ihre Hilfe bei der Überarbeitung des Textes. Luise Becker möchte ich für das Korrekturlesen danken. Ein besonderer Dank geht an meine Gesprächspartner*innen, die ihre Ideen, Meinungen und Erfahrungen mit mir teilten. Aus Gründen der Anonymität und zum Schutz ihrer Sicherheit kann ich sie hier nicht namentlich nennen.
6 Short-Bio
Nurhak Polat is a social anthropologist affiliated with the Department of Anthropology and Cultural Studies at the University of Bremen, Germany. She holds a doctoral degree in European Ethnology from Humboldt University in Berlin. Her research and teaching interests encompass medical anthropology, science and technology studies, gender and masculinity studies, anthropology and ethnography of Turkey, internet ethnography, digital technologies, and authoritarianism. She is the author of „Umkämpfte Wege der Reproduktion: Kinderwunschökonomien, Aktivismus und sozialer Wandel in der Türkei“ (transcript, 2018) and a co-editor of „Europa dezentrieren: Globale Verflechtungen neu denken“ (Campus, 2019). Currently, she is engaged in postdoctoral research that examines the interactions between authoritarianism, digital technologies, and data politics.
Autor*innenbeiträge
Nurhak Polat hat die Daten erhoben und den Beitrag verfasst.
Datenverfügbarkeit
Alle relevanten Daten befinden sich innerhalb der Veröffentlichung.
Interessenskonfliktstatement
Die Autorin erklärt, dass ihre Forschung ohne kommerzielle oder finanzielle Beziehungen durchgeführt wurde, die als potentielle Interessenskonflikte ausgelegt werden können.
Referenzen
Akarsu, H. (2020). Digital hailing: Social media and police work. Society for the Anthropology of Work. https://doi.org/10.21428/1d6be30e.27969821
Akcinar, M., Cantini, D., Kreil, A., Naef, S. & Schaeublin, E. (2018). No Country for Anthropologists? Ethnographic Research in the Contemporary Middle East. Conference Report. (S. 33–36).
Akkoyunlu, K. & Öktem, K. (2016). Existential insecurity and the making of a weak authoritarian regime in turkey. Southeast European and Black Sea Studies, 16(4), 505–527. https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1253225
Amelang, K. & Bauer, S. (2019). Following the algorithm: How epidemiological risk-scores do accountability. Social Studies of Science, 49(4), 476–502. https://doi.org/10.1177/0306312719862049
Aydın-Düzgit, S., Kutlay, M. & Keyman, E. F. (2021). Politics of pandemic management in Turkey. IPC Policy Brief. Verfügbar unter: https://politicsofpandemic.com/api/uploads/Turkey_pandemic_policy_briefing_published_3464d16146.pdf
Bakir, C. (2020). The turkish state’s responses to existential COVID-19 crisis. Policy and Society, 39(3), 424–441. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1783786
Bell, G., Gould, M., Martin, B., McLennan, A. & O’Brien, E. (2021). Do more data equal more truth? Toward a cybernetic approach to data. Australian Journal of Social Issues, 56(2), 213–222. https://doi.org/10.1002/ajs4.168
Benjamin, R. (2019). Race after technology: abolitionist tools for the new Jim code. Medford, MA: Polity.
Beraldo, D. & Milan, S. (2019). From data politics to the contentious politics of data. Big Data & Society, 6(2), 1–11. https://doi.org/10.1177/2053951719885967
Bigo, D., Isin, E. F. & Ruppert, E. S. (Hrsg.). (2019). Data politics: worlds, subjects, rights (Routledge studies in international political sociology). London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Biruk, C. (2018). Cooking data: culture and politics in an African research world (Critical global health: evidence, efficacy, ethnography). Durham: Duke University Press.
Blouin, G. G. (2020). Data performativity and health: The politics of health data practices in europe. Science, Technology, & Human Values, 45(2), 317–341. https://doi.org/10.1177/0162243919882083
Boellstorff, T. & Maurer, B. (Hrsg.). (2015). Data: Now bigger and better! Prickly Paradigm Press. Zugriff am 26.5.2023. Verfügbar unter: https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/D/bo20285526.html
Bonilla, Y. & Rosa, J. (2015). #Ferguson: Digital protest, hashtag ethnography, and the racial politics of social media in the united states: #Ferguson. American Ethnologist, 42(1), 4–17. https://doi.org/10.1111/amet.12112
Cesarino, L. (2021). The Bolsonaro government’s response to the covid-19 pandemic and the paradox of digitally-mediated authoritarian populism in Brazil. DGSKA-Tagung 2021: Worlds. Zones. Atmospheres. Seismographies of the Anthropocene. Universität Bremen.
Çalışkan, K. (2018). Toward a new political regime in turkey: From competitive toward full authoritarianism. New Perspectives on Turkey, 58, 5–33. https://doi.org/10.1017/npt.2018.10
Datta, A. (2020). Self(ie)-governance: Technologies of intimate surveillance in india under COVID-19. Dialogues in Human Geography, 10(2), 234–237. https://doi.org/10.1177/2043820620929797
D’Ignazio, C. & F. Klein, L. (2020). Seven intersectional feminist principles for equitable and actionable COVID-19 data. Big Data & Society, 7(2), 205395172094254. https://doi.org/10.1177/2053951720942544
Douglas–Jones, R., Walford, A. & Seaver, N. (2021). Introduction: Towards an anthropology of data. Journal of the Royal Anthropological Institute, 27, 9–25. https://doi.org/10.1111/1467-9655.13477
Edelman, M. (2020). From „populist moment“ to authoritarian era: Challenges, dangers, possibilities. The Journal of Peasant Studies, 47(7), 1418–1444. https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1802250
Erikson, S. L. (2018). Cell phones ≠ self and other problems with big data detection and containment during epidemics: Problems with big data detection and containment. Medical Anthropology Quarterly, 32(3), 315–339. https://doi.org/10.1111/maq.12440
Foucault, M. (1977). Der Panoptismus. In Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses (S. 251–291). Suhrkamp.
Foucault, M. (2005). Subjekt und Macht. In Analytik der Macht (S. 240–263). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Geismar, H. & Knox, H. (Hrsg.). (2021). Digital anthropology (2. Auflage). Second edition. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2021. Revised edition of: Digital anthropology / edited by Heather A. Horst; Daniel Miller. London; New York : Berg, 2012.: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003087885
Glasius, M., De Lange, M., Bartman, J., Dalmasso, E., Lv, A., Del Sordi, A. et al. (2018). Research, ethics and risk in the authoritarian field. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68966-1
Glasius, M. & Michaelsen, M. (2018). Illiberal and Authoritarian Practices in the Digital Sphere - Prologue. International Journal of Communication, 12, 3795–3813.
Gökarıksel, S. & Türem, Z. U. (2019). The banality of exception? South Atlantic Quarterly, 118(1), 175–187. https://doi.org/10.1215/00382876-7281684
Gray, P. A. (2016). Memory, body, and the online researcher: Following russian street demonstrations via social media: Memory, body, and the online researcher. American Ethnologist, 43(3), 500–510. https://doi.org/10.1111/amet.12342
Halikiopoulou, D. (2020, April 1). The pandemic is exposing the weaknesses of populism, but also fuelling authoritarianism. LSE.
Hine, C. (2017). Ethnography for the internet: Embedded, embodied and everyday (1. Auflage). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003085348
Hoeyer, K. (2023). Data paradoxes: the politics of intensified data sourcing in contemporary healthcare (Infrastructures series). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Hou, R. (2022). Beyond big brother: How to study tech-driven authoritarianism with restricted access to state institutions. Ethnography, 1–20. https://doi.org/10.1177/14661381221120208
Kisa, A. (2021). Turkey’s COVID-19 strategy: „The west is jealous of us“. Journal of Public Health Policy, 42(4), 612–621. https://doi.org/10.1057/s41271-021-00314-w
Kitchin, R. (2014). The data revolution: big data, open data, data infrastructures & their consequences. Los Angeles: SAGE.
Kitchin, R. (2020). Civil liberties or public health, or civil liberties and public health? Using surveillance technologies to tackle the spread of COVID-19. Space and Polity, 24(3), 362–381. https://doi.org/10.1080/13562576.2020.1770587
Kitchin, R. & Lauriault, T. P. (2014). Towards critical data studies: Charting and unpacking data assemblages and their work (Geoweb and big data).
Klausner, M. (2022). Eine „mehr-als-digitale Anthropologie“. Ethnografien der Partizipation und öffentlichen Verwaltung. Zeitschrift für Empirische Kulturwissenschaft, 2022, 5–24. https://doi.org/10.31244/zekw/2022.02
Knox, H. & Nafus, D. (2018). Ethnography for a data-saturated world (Materialising the digital). Manchester: Manchester university press.
Koch, G. (2018). Zur „Datafication“ der Wissensproduktion in der qualitativen Forschung. In I. digital Studien zur Landesgeschichte und Kulturanthropologie 1 (Hrsg.), Forschungsdesign 4.0 Datengenerierung und Wissenstransfer in interdisziplinärer Perspektive (S. 180–195). Dresden: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde.
Koopman, C. (2019). How we became our data: a genealogy of the informational person. Chicago: The University of Chicago Press.
Küçük, B. & Özselçuk, C. (2019). Fragments of the emerging regime in turkey. South Atlantic Quarterly, 118(1), 1–21. https://doi.org/10.1215/00382876-7281564
Lentine, G. S. & Tali, D. (2020, Juli 21). Turkey is Using Pandemic to Tighten Chokehold on Free Expression. Balkan Insight. Zugriff am 17.5.2023. Verfügbar unter: https://balkaninsight.com/2020/07/21/turkey-is-using-pandemic-to-tighten-chokehold-on-free-expression/
Liu, C. & Graham, R. (2021). Making sense of algorithms: Relational perception of contact tracing and risk assessment during COVID-19. Big Data & Society, 8(1), 205395172199521. https://doi.org/10.1177/2053951721995218
Lozano, C. M. (2020, April 5). Seeing covid-19, or a visual journey through the epidemic in three acts, writes cristina moreno lozano – COVID-19 perspectives. Somatosphere: Science, medicine, and anthropology. Zugriff am 24.5.2023. Verfügbar unter: https://blogs.ed.ac.uk/covid19perspectives/2020/04/06/seeing-covid-19-or-a-visual-journey-through-the-epidemic-in-three-acts-writes-cristina-moreno-lozano
Lyon, D. (2022). Pandemic surveillance. Cambridge: Polity Press.
Maschewski, F. & Nosthoff, A.-V. (2022). Überwachungskapitalistische Biopolitik: Big Tech und die Regierung der Körper. Zeitschrift für Politikwissenschaft, 32(2), 429–455. https://doi.org/10.1007/s41358-021-00309-9
Mason, K. A. (2016). The correct secret. Focaal, 2016(75), 45–58. https://doi.org/10.3167/fcl.2016.750104
Milan, S., Treré, E. & Masiero, S. (Hrsg.). (2021). COVID-19 from the margins: pandemic invisibilities, policies and resistance in the datafied society (Theory on demand). Amsterdam: Institute of Network Cultures.
Odman, A. (2019). ‚Sivil Veri İnisiyatifleri ve Veri Müşterekleri‘, Burak Arıkan ile söyleşi. Verfügbar unter: https://www.academia.edu/39875445/Sivil_Veri_İnisiyatifleri_ve_Veri_Müşterekleri_Burak_Arıkan_ile_söyleşi
Odman, A. & Tülek, M. (2021). Covid 19 Pandemisi Sırasında Sosyo-mekânsal Eşitsizlikler ve Veri ile Halk Sağlığı Ilişkisi. Verfügbar unter: https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_Part60.pdf
Ong, A. & Collier, S. J. (Hrsg.). (2005). Global assemblages: technology, politics, and ethics as anthropological problems. Malden, MA: Blackwell Publishing.
Oztig, L. I. (2022). Policy styles and pandemic management: The case of turkey. European Policy Analysis, 8(3), 261–276. https://doi.org/10.1002/epa2.1155
Polat, N. (2020b). Dijital pandemi gözetimi, beden politikaları ve eşitsizlikler [Digital pandemic surveillance, body politics and inequalities]. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, (41), 94–107.
Randeria, S. (2021, März 3). Spielarten des „sanften“ Autoritarismus: Wie Demokratien demokratisch ausgehöhlt werden. Universität Innsbruck.
Rottenburg, R., Merry, S. E., Park, S.-J. & Mugler, J. (Hrsg.). (2015). The world of indicators: the making of governmental knowledge through quantification. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
Ruckenstein, M. & Schüll, N. D. (2017). The datafication of health. Annual Review of Anthropology, 46(1), 261–278. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102116-041244
Ruppert, E., Isin, E. & Bigo, D. (2017). Data politics. Big Data & Society, 4(2), 205395171771774. https://doi.org/10.1177/2053951717717749
Saka, E. (2016). Siyasi trollük örneği olarak Aktroller. Birikim, (322), 17–21.
Saluk, S. (2022). Datafied pregnancies: Health information technologies and reproductive governance in turkey. Medical Anthropology Quarterly, 36(1), 101–118. https://doi.org/10.1111/maq.12675
Sastramidjaja, Y. L. M. & Wijayanto. (2022). Cyber troops, online manipulation of public opinion and co-optation of Indonesia’s cybersphere (1 ed.). Singapore: ISEAS Publishing. https://doi.org/10.1355/9789815011500-003
Scheppele, K. L. (2018). Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review, 85(2), 545–584.
Scott, J. C. (1999). Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed (Veritas paperback edition.). New Haven: Yale University Press.
Sotiris, P. (2020). Against Agamben: Is a Democratic Biopolitics Possible? Critical Legal Thinking. Verfügbar unter: https://criticallegalthinking.com/2020/03/14/against-agamben-is-a-democratic-biopolitics-possible/
Topak, Ö. E. (2014). The biopolitical border in practice: Surveillance and death at the greece-turkey borderzones. Environment and Planning D: Society and Space, 32(5), 815–833. https://doi.org/10.1068/d13031p
Waisbord, S. & Soledad Segura, M. (2021). COVID-19 Pandemic and Biopolitics in Latin America (Theory on demand). In S. Milan, E. Treré & S. Masiero (Hrsg.), COVID-19 from the margins: pandemic invisibilities, policies and resistance in the datafied society. Amsterdam: Institute of Network Cultures.
Zigon, J. (2015). What is a Situation?: An Assemblic Ethnography of the Drag War. Cultural Anthropology, 30(3), 501–524. https://doi.org/10.14506/ca30.3.07
Zuboff, S. (2018). Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. (B. Schmid, Übers.). Frankfurt am Main New York: Campus Verlag.
Zurawski, N. (2020). Pandemische Landschaften: Corona und die Räume der Überwachung. In C. Stegbauer & I. Clemens (Hrsg.), Corona-Netzwerke – Gesellschaft im Zeichen des Virus (S. 75–86). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31394-4_8
Aus einer Rede von Şuayip Birinci, stellvertretender Gesundheitsminister und unter anderem verantwortlich für den digitalen Transformationsprozess im Gesundheitswesen der Türkei, bei HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı / Health it Conference and Exhibition (11.-13. November 2020) entnommen. Siehe: https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-bakan-yardimcisi-duyurdu-izolasyondakiler-icin-elektronik-bileklik-uygulamasi-geliyor-11-681-92353.html (Zugriff am 14.11.2020).↩︎
Hier bezieht Koopman sich auf James Scott (1999) „Seeing Like a State“. in dem die bürokratischen und staatlichen Technologien des Lesbarmachens als Manipulationswege beschrieben werden.↩︎
Autoritarismus ist nicht als ein absolutes, in sich geschlossenes System zu betrachten. Autoritäre Systeme der Gegenwart grenzen sich kaum von den (liberalen) Demokratien ab. Eher bauen sie ihre Macht auf demokratischen Strukturen und liberal-demokratischen Institutionen auf, wobei sie diese mit verschiedenen, illiberalen Strategien von innen heraus verändern. Laut der Anthropologin und Soziologin Shalini (Randeria, 2021) spielen sie strategisch mit den „fuzzy boundaries“, das heißt unscharfen und fragilen Grenzen zwischen autoritären und demokratischen Regierungsformen. Der Begriff Soft Authoritarianism weist darauf hin. Ihre Research-Group Soft Authoritarianisms an der Universität Bremen erkundet, wie heutige Autoritarismen ihre Macht und Legitimität auf den strategischen Einsatz und den kalkulierten Abbau von demokratischen Strukturen bauen. Als assoziiertes Mitglied der Forschungsgruppe erkunde ich diese und ähnliche Fragen in digitalen, datafizierten Zeiten.↩︎
Die Türkei zählt mit zunehmend autokratischer Repression gegenüber Wissenschaft(ler*innen) und Forschenden in vielerlei Hinsicht zu den risikobehafteten Forschungslandschaften (Akcinar, Cantini, Kreil, Naef & Schaeublin, 2018). Dies verstärkte sich seit der Friedenspetition im Jahr 2016, einem Appell von mehr als 1.000 Akademiker*innen an den türkischen Staat und die AKP-Regierung für den Frieden in den kurdischen Gebieten. Als eine der Erstunterzeichner*innen war auch für mich die Forschung, wie bereits vor der Pandemie, nicht frei von Risiken und Sorgen.↩︎
Verschiedene Analysen verweisen auf einen autokratischen Abbau der demokratischen Strukturen. In Anlehnung an Kim Scheppele (2018) zu Ungarn legen sie die Bedeutung verwischender Grenzen von Justiz, Willkür und Staatsmacht offen. Mit Verweis auf „autokratischen Legalismus“ argumentieren Gökariksel und Türem, dass eine vorsätzliche Verformung der verfassungsrechtlichen, juristischen und politischen Strukturen auch für den türkischen Autoritarismus charakteristisch ist. Während der nun über 20 Jahre anhaltenden Herrschaft setzte die Regierung Legalität systematisch als Mittel zur Konsolidierung der politischen Macht ein und erzeugte eine Banalität der Ausnahmezustände.↩︎
Die „Ansprache an die Nation“ von Recep Tayyip Erdoğan (siehe https://www.youtube.com/watch?v=UllerxOEesE&t=6s) (Zugriff am 25.03.2020)↩︎
Sowohl rhetorisch als auch politisch adressierte die Regierung den Westen im Außen und die Dissident*innen im Inland als muhteris, feindselige Ehrgeizige, „diejenigen, die sich die Hände reiben und darauf warten, dass die Türkei stolpert (…) in Chaos und Krise hineingezogen wird“ und „diejenigen, die versuchen, unsere Nation mit gefälschten Nachrichten zu demoralisieren und Chaos zu verursachen“ (siehe: https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/cumhurbaskani-erdogan-mecburiyeti-olmayan-hicbir-vatandasimiz-tehdit-ortadan-kalkana-kadar-evinden-cikmamali/1770590, Zugriff am 20.03.2020; siehe: https://mobile.twitter.com/aacanli/status/1383401113806721033, Zugriff am 17.04.2021)↩︎
Dies ist die aus elf Ziffern bestehende personenspezifische Identifikationsnummer, über die jede*r Staatsbürger*in verfügt. Damit sind Bürger*innen in E-Governance registriert. Sie müssen diese Nummer im Zuge einer Reihe von Tätigkeiten vorlegen und angeben – sei es bei Behördengängen, beim Einkaufen, im Krankenhaus oder auf Reisen. Anhand der Identifikationsnummer werden unterschiedliche Daten gesammelt, registriert, an mehreren Speicherorten aufbewahrt und zwischen verschiedenen Institutionen geteilt.↩︎
Siehe Fußnote 1.↩︎
https://tr.euronews.com/2021/01/05/rapor-turkiye-covid-19-verilerinin-seffafl-g-listesinde-sondan-4-uncu-s-rada (Zugriff am 05.02.2021).↩︎
Siehe „COVID-19 Pandemisi 1. Yıl Değerlendirmesi“ am 11.03.2020, live übertragen, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=phlwheCJ6M0.↩︎
0 von Crossref erfasste Zitate
0 von Semantic Scholar erfasste Zitate
Erhalten
Akzeptiert
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenzinformation
Copyright (c) 2023 Nurhak Polat

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.