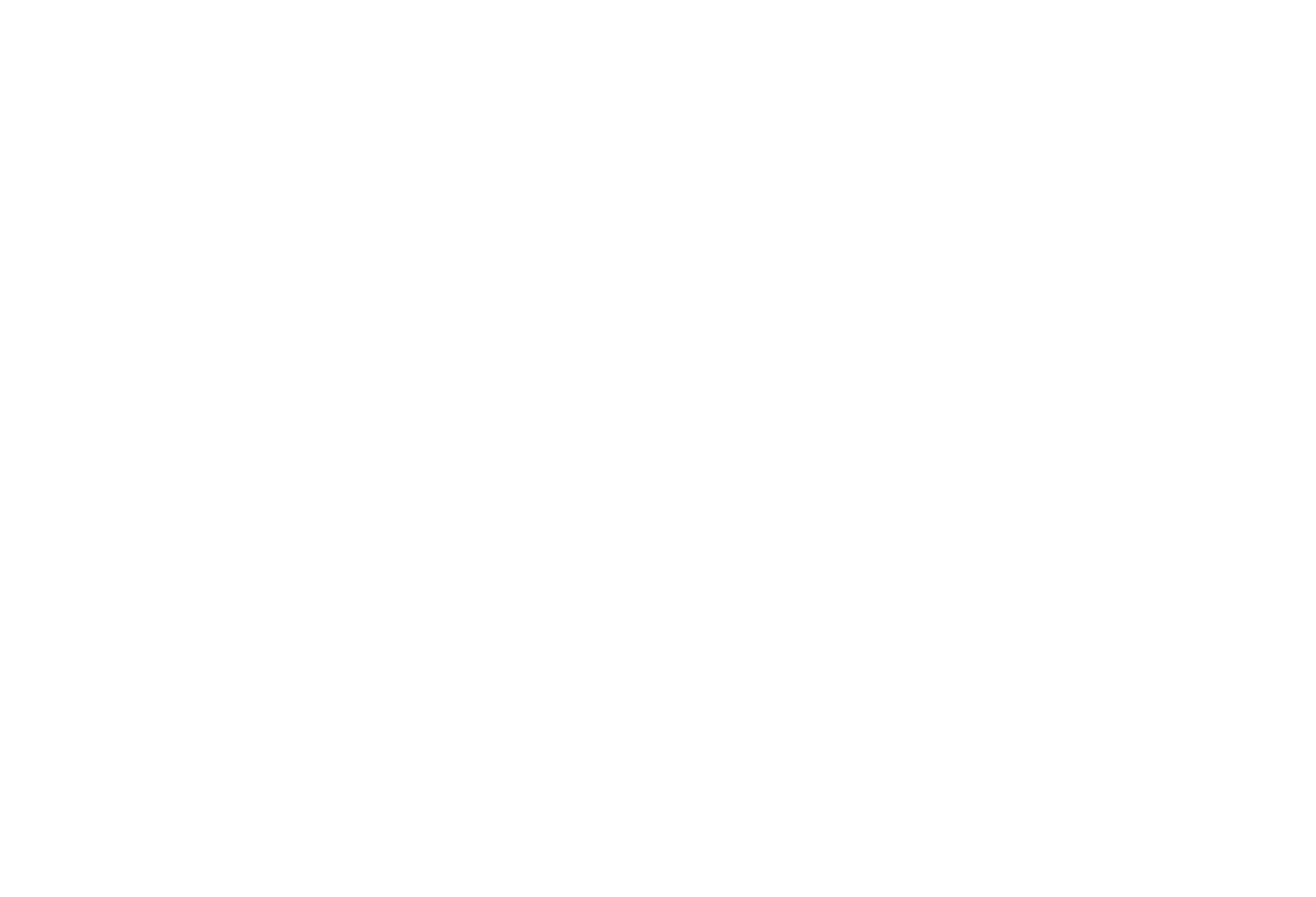#selberdenken.
Die Artikulation von Systemmisstrauen und die Beanspruchung epistemischer Autonomie in der Corona-Krise
DOI:
https://doi.org/10.15460/kommges.2022.23.1.1051Schlagworte:
Aufklärung, Corona-Skeptizismus, Evidenzpraktiken, Hashtag, Hermeneutik, Soziale Medien, Systemmisstrauen, WissenschaftRedaktion und Begutachtung
Abstract
Soziale Medien stellen wichtige Bühnen für zeitgenössische Konflikte um Wissen und Wahrheit dar. Der Artikel widmet sich vor diesem Hintergrund dem Gebrauch des Hashtags #selberdenken auf Twitter. Mittels einer quantitativen Datenanalyse wird zunächst die Konjunktur der Verwendung des Hashtags nachgezeichnet. Eine anschließende hermeneutische Sequenzanalyse zeigt, wie in seinem Gebrauch ein Anspruch auf epistemische Autonomie zum Ausdruck gebracht wird: Allein die eigenen Erfahrungen, Interpretationen und Quellen gelten als vertrauenswürdig. Dies korrespondiert mit einem grundlegenden Misstrauen in die von den Massenmedien konstruierten Realitäten und einer Trivialisierung von Erkenntnisprozessen. Die Untersuchung leistet einen Beitrag zum Verständnis der kommunikativen Mikrostrukturen mediatisierter Wissenskonflikte und der Rolle, die ein öffentlich kommunizierter Skeptizismus in ihnen spielt.
1 Einleitung
Im gesellschaftlichen Umgang mit COVID-19 zeigt sich, dass die politischen Auseinandersetzungen unserer Zeit auch und gerade die Form epistemischer Konflikte annehmen können – also Konflikte darüber, wer das bessere Wissen besitzt, wie die Grenzen von Wissen und Nicht-Wissen gezogen werden und welche Akteur:innen und Institutionen in welchen Konstellationen Wahrheitsansprüche erheben können (Bogner, 2021, S. 18). Die sozialwissenschaftliche Reflexion der öffentlichen Verhandlung der Corona-Krise zeichnete sich gerade zu Beginn der Pandemie vor allem durch theoretische und gesellschaftsdiagnostische Beiträge aus (Dörre, 2020; Keitel, Volkmer & Werner, 2020). Später traten Untersuchungen zu den politischen Haltungen und weltanschaulichen Hintergründen von Kritiker:innen der staatlichen Deutungen und Maßnahmen hinzu (Frei & Nachtwey, 2021; Frei, Schäfer & Nachtwey, 2021). In ihrer empirischen Untersuchung der Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen kommen Frei & Nachtwey (2021) zu dem Schluss, dass sich trotz aller politischen und normativen Heterogenität sowie der inhaltlichen Diffusität der Kritik einige verbindende Merkmale der Corona-Protestbewegung finden lassen. Deren Kritik könne im Anschluss an Boltanski (2010) als Form der Herrschaftskritik interpretiert werden, in der sich ein grundsätzliches Misstrauen gegen etablierte Institutionen öffentlich artikuliere. Der als einseitig und partikular gedeuteten Realität der Institutionen stelle die Corona-Protestbewegung eine alternative Konstruktion der Wirklichkeit gegenüber. Im Zentrum der Kritik stünden dabei das politische System sowie das System der Massenmedien. Die moderne Wissenschaft werde hingegen nicht grundsätzlich kritisiert. Stattdessen gingen die Maßnahmen-Kritiker:innen davon aus, dass die Wissenschaft von Politik und Massenmedien verzerrt dargestellt wird. In ihrer Kritik würden sich die Kritiker:innen damit selbst wissenschaftsförmig positionieren und in die Rolle aufklärender Expert:innen schlüpfen (Frei et al., 2021, S. 257f.). Dabei bestehe in dieser Protestbewegung zumindest eine „Anlage zum verschwörungstheoretischen Denken“ (Frei et al., 2021, S. 253)1 Die Kritiker:innen bezögen sich auf wissenschaftliche Werte und Normen, um diese letztlich zu unterminieren (ebd. S. 26f.).
Zeitgenössische Formen politisch-epistemischer Kritik haben auch und gerade eine mediale Dimension (Bucher & Duckwitz, 2005). Medien liefern Bühnen für Protest und Kritik, sie geben Akteur:innen die Möglichkeit, Publika zu adressieren und eröffnen oder blockieren Wege der Anschlusskommunikation. So wie Bühnenarchitekturen ihren Aufführungen einen spezifischen Rahmen verleihen, begünstigen, prägen und formen mediale Infrastrukturen die Modi der Kommunikation, die sich auf ihnen abspielen (Dolata & Schrape, 2014). Dass gerade soziale Medien verschwörungstheoretische Kommunikationsstile befördern können, ist ein Gemeinplatz zeitgenössischer Diagnosen zur digitalen Gesellschaft geworden. Bereits vor 25 Jahren, also noch vor der prominenten Diskussion um Echokammern und Filterblasen (Pariser, 2011),2 wies Josef Wehner auf subkutane Nebenfolgen interaktiver Medien hin. Massenmedien würden die „Aufmerksamkeit einer unbegrenzten Zahl von Rezipienten auf eine eng begrenzte Zahl von Aussagen“ (Wehner, 1997, S. 101) lenken, so die Selektivität ihrer Themenwahl latent halten und gerade dadurch den Anschein von Verallgemeinerungsfähigkeit generieren. Mit den Partizipationsmöglichkeiten des Internets hingegen träte die Selektivität der Themenwahl nun selbst in den Vordergrund öffentlicher Kommunikation und damit würde die „Realität der Massenmedien“ (Luhmann, 1996) in ihrer Kontingenz sichtbar (Wehner, 1997, S. 103). Daraus leitet Wehner die Diagnose ab, dass interaktive Medien zum einen eine Fragmentierung des Öffentlichen befördern würden. Zum anderen böten sie durch Generalisierung des Skeptizismus und der erleichterten Anschlussfähigkeit für Heterodoxien auch Räume für Verschwörungsmythen aller Art. „Ihre Botschaft ist die Differenz zwischen der ‚Scheinwirklichkeit’, wie sie vor allem durch die Massenpresse erzeugt wird, und der „realen Wirklichkeit“, die sich hinter offiziellen Darstellungen und Verlautbarungen verbirgt” (Wehner, 1997, S. 109).3 Wehner nahm damit die heute populäre Diagnose vorweg, dass soziale Medien Wegbereiter eines post-faktischen Zeitalters seien, indem sie ‚alternative Fakten’ als user-generated content öffentlich kommunizierbar und anschlussfähig machen.
Aber auch jenseits solch breiter Zeitdiagnosen werden soziale Medien zunehmend als Herausforderung für die Kommunikation glaubwürdigen Wissens begriffen (acatech, 2017; Gierth & Bromme, 2020; Könneker, 2020; Weingart & Guenther, 2016) da sie einen Raum zur Kommunikation unautorisierter Beobachtungen bieten (Brüggemann, Lörcher & Walter, 2020, S. 8) oder sogar ganz grundsätzlich verunklaren, wer überhaupt im Namen der Wissenschaft sprechen darf (Wenninger, 2019). Auch neuere Studien, die spezifisch auf die pandemische Situation abzielen, bestätigen einerseits die wichtige Rolle sozialer Medien als Vermittlungsinstanz pandemiebezogener Informationen, weisen aber andererseits darauf hin, dass gerade zu COVID-19 Desinformationen und Verschwörungstheorien florieren. „[S]ocial media has a crucial role in people's perception of disease exposure, resultant decision making, and risk behaviours. As information on social media is generated by users, such information can be subjective or inaccurate, and frequently includes misinformation and conspiracy theories“ (Tsao et al., 2021, S. 1).
Gleichwohl liegen bislang wenige Untersuchungen vor, die empirisch zeigen, wie der Corona-Skeptizismus sich auf sozialen Medien eigentlich kommunikativ konkret vollzieht. So argumentiert Kumkar (2022), dass ‚alternative Fakten’ weniger in ihrer inhaltlichen Architektur und umso mehr in ihrer kommunikativen Dimension untersucht werden sollten. Er betrachtet die Inanspruchnahme alternativer Fakten als kommunikative Strategie, die in spezifischer Weise in einen gesellschaftlichen Diskurs interveniert. Mit dem Verweis auf alternative Fakten wird etwas kommunikativ performiert, was aber empirisch noch unzureichend verstanden ist: „Denn auch wenn die Veröffentlichungen zu alternativen Fakten inzwischen kaum noch zu überschauen sind, wissen wir bisher erstaunlich wenig darüber, was alternative Fakten in ihren jeweiligen kommunikativen Kontexten eigentlich machen. Genauer, wie setzt man sie eigentlich, ganz pragmatisch, als kommunikative Schachzüge im Spiel der gesellschaftlichen Debatte ein?“ (Kumkar, 2022, S. 17f.).
Hier setzt unser Beitrag an. Er ergänzt die bisherigen sozialwissenschaftlichen Reflexionen und Beobachtungen durch einen Zugang, der die mediatisierten Kommunikationsstrukturen des Corona-Skeptizismus in den Blick nimmt. Wir rekonstruieren mithilfe einer hermeneutischen Sequenzanalyse4 die Artikulation des Corona-Skeptizismus am Fall des sozialen Netzwerkes Twitter. Uns geht es dabei um eine Untersuchung der „Mikrostrukturen“ (Bora & Münte, 2012) konkret kommunizierten Systemmisstrauens. Die diesbezüglichen Kommunikationsstrukturen werden im Folgenden anhand der Analyse des Hashtags #selberdenken sowie ausgewählter Tweets, die ihn verwenden, rekonstruiert.
Wir werden dabei zeigen, dass in den von uns untersuchten Tweets ein Misstrauen in institutionelle Wissenssysteme zum Ausdruck kommt. Als Alternative zu einem „Systemvertrauen“ (Luhmann, 2014) in organisierte und kollektive Prozesse der Wissensproduktionen artikuliert sich im #selberdenken ein des-organisiertes und individualistisches Modell des Skeptizismus, das ‚Aufklärung’ nutzt, um ein Vertrauen in die eigenen Sinne und die je subjektiven Erkenntnismöglichkeiten zu propagieren.
2 Der Hashtag #selberdenken
Hashtags (markiert mit dem Symbol #) finden seit mehreren Jahren auf Social-Media-Plattformen Verwendung, um eigene Beiträge zu verschlagworten. Der Begriff bezeichnet sowohl das Symbol selbst als auch das Wort, das mit demselben versehen wird. Dabei verbindet der Hashtag zwei historische Funktionen von Schlagworten: der Organisation von Wissen und der wiedererkennbaren Zuspitzung von Themen im öffentlichen Diskurs. Die erste Verwendungspraxis geht auf Bibliothekar:innen und Wissenschaftler:innen zurück, die zweite findet sich im Journalismus, der Werbung und der Politik. Es waren im 20. Jahrhundert also vornehmlich professionelle Gruppen und gesellschaftliche Eliten, die Schlagworte benutzten. Die Verwendung von Hashtags in sozialen Medien popularisiert die Praxis der Verschlagwortung. Die Möglichkeit, das #-Symbol unmittelbar vor ein Wort zu platzieren, verwandelt potenziell jedes Wort in ein Schlagwort. Es gibt dabei keine normativen Vorgaben zum richtigen Gebrauch von Hashtags. Vielmehr begründet die Verwendung des Symbols entweder den Versuch, ein neues Thema zu besetzten oder aber es markiert die Zugehörigkeit eines Beitrags zu einem bereits bestehenden Diskurs (Bernard, 2018).
Um unseren Gegenstand zu kontextualisieren, wollen wir zunächst die quantitative Verbreitung des Hashtags #selberdenken5 und seiner Beziehung zu anderen Hashtags aufzeigen. Mit dieser empirischen Analyse wollen wir zeigen, wie der Hashtag vor und während der Corona-Pandemie von User:innen auf der Social-Media-Plattform Twitter eingesetzt wird. Daran lässt sich ablesen, mit welchen thematischen Bezügen der Hashtag zusammen auftritt und ob es im Laufe der Corona-Krise eine Veränderung gegeben hat.
2.1 Die Twitter-Karriere des Hashtags #selberdenken
Der Hashtag ‚selberdenken’ taucht auf Twitter in deutschsprachigen Tweets erstmalig am 18. März 2009 auf. Im Folgenden werden Ergebnisse einer quantitativen Berechnung von textuellen Daten vorgestellt und interpretiert, die zum einen den gesamten Corona-Zeitraum bis einschließlich 27. April 2022 und, zum anderen, einen Zeitraum von zehn Jahren vor Corona umfassen.
Die zur Analyse vorliegenden Tweets wurden mithilfe der Twitter API (Application Programming Interface) von Twitter extrahiert. Die Filterkriterien waren der Hashtag #selberdenken als Muster in all seinen Schreibvarianten6, die Zeiträume und die deutsche Sprache.
Abbildung 1 zeigt die 30 am häufigst genannten Hashtags im Datensatz vom 18.03.2009 bis zum 30.12.2019. Dieser Datensatz ist über einen sehr viel längeren Zeitraum weniger als halb so groß, wie der der Corona-Pandemie. Entfernt man nicht verfügbare Accounts und Retweets, die selbst keinen Hashtag ‚selberdenken’ enthalten, verbleiben von den ursprünglich 668 noch 568 Tweets. Der #selberdenken befindet sich 569 Mal im Datensatz – da ein Tweet den #selberdenken doppelt verwendet. Damit entsteht ein weiter Abstand zum darauffolgenden #augenauf, welcher 33 Mal vorkommt.
Mit Hinblick auf die ersten Einträge im Datensatz und auf die Abbildung 1 scheint von Beginn an eine politische Färbung des #selberdenken erkennbar zu werden. Dies bestätigt sich mit den Hashtags #afd, #piraten, #politik, #btw17 (Bundestagswahl 2017), #piratenpartei oder #noafd. Auch medienbezogene Thematiken schienen bereits über den der Pandemie vorangegangenen Zeitraum wichtig gewesen zu sein. So treten hier #meinungsfreiheit, #zensur, #tvboykott auf.
Des Weiteren kann eine thematische Nähe zum Thema ‚Denken’ (#gedanken, #denken, #nachdenken) ausgemacht werden als auch zu grundsätzlichen politischen Werten wie #demokratie oder #freiheit. Zumindest vier Mal erscheint der Aufruf nach #alternativen. Somit scheint der Hashtag #selberdenken bereits politisch vorgeprägt gewesen zu sein, jedoch keineswegs mit gesundheitlichen oder politisch klar konturierten Positionen. Denn mit Hashtag-Verknüpfungen werden dem ‚Selberdenken’ durch #noafd oder #piraten zwei entgegengesetzte Positionen im Spektrum des deutschen Parteiensystems angefügt.
Viele der in Kombination mit dem #selberdenken verwendeten Hashtags würden allerdings bereits im Zeitraum von 2009 bis 2019 zu Themen der COVID-19 Pandemie passen, wie beispielsweise: #augenauf, #afd, #meinungsfreiheit, #tvboykott, #freiheit, #aufwachen, #usa oder #alternativen. Dennoch ist das Spektrum der verknüpften Hashtags heterogener, positiver und noch gesellschaftlich anschlussfähiger, das heißt die Hashtag-Verbindungen rahmen eine breitere Adressierbarkeit von Themen. Dazu passt auch, dass der Hashtag #selberdenken häufig alleine auftritt. Dies ist in 297 Tweets im Zeitraum vor COVID-19 der Fall. Über die logische Schlussfolgerung hinaus – #selberdenken war das Suchkriterium – zeichnet sich dadurch ab, dass das ‚Selberdenken’ relativ unabhängig von anderen Themengebieten verwendet wird.
Werden diese Daten den Tweets während der COVID-19-Pandemie gegenübergestellt, ergibt sich ein verändertes Bild. In Abbildung 2 sehen wir die Verwendung des #selberdenken während der Corona-Pandemie vom 3. Januar 2020 bis zum 27. April 2022. Unter Ausschluss der Retweets ohne Hashtags bleibt ein Datensatz von 1511 Tweets mit insgesamt 1240 Hashtags bestehen. Der Hashtag ‚selberdenken’ ist erneut der mit Abstand häufigste Hashtag im Datensatz. Er wird 1078 Mal genutzt, gezählt als eigener Tweet eines oder einer User:in als auch in Retweets. Auffällig ist in dieser Grafik, dass der Hashtag oft in Verbindung mit weiteren COVID-19 thematisierenden Hashtags auftritt. Diese sind beispielsweise: #covidioten, #coronazis, #corona, #coronaleugner, #coronanazis oder #covid19. Neben dem Coronavirus scheint sich hier eine eher negative Konnotation anzudeuten die mit dem #selberdenken verknüpft wird. Hashtag-Verbindungen kommen jetzt häufiger vor, welches einen einheitlicher werdenden Themenkomplex andeutet.
Weiterhin werden Themen angesprochen, die besonders während der Corona-Krise an Aktualität gewonnen haben. Erwähnt werden jetzt spezifische Protestbewegungen und -ereignisse, Corona-Schutzimpfungen und #querdenken – also alles Themen, die erst mit dem SARS-CoV-2 Virus aufkamen (#querdenker, #impfung, #impfpflicht, #demo oder #koelnistaktiv). So wird etwa unter dem Hashtag #koelnistaktiv zu Protesten in der Stadt Köln aufgerufen, um für ‚Freiheit’ und ‚Selbstbestimmtheit’ auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren.
Auch sind weiterhin thematische Bezüge zu #medien oder #nachrichten zu registrieren. Mithin scheint damit deutlich zu werden, dass es vor und während der Pandemie eine ausgeprägte Verbindung des Hashtag-Gebrauchs zum Journalismus oder den Massenmedien zu geben scheint. Darüber hinaus beschreibt Abbildung 2 die Zusammenhänge zwischen dem #selberdenken und verwandten Themengruppen die sich mit dem Denken als Prozess befassen, wie #querdenken, #leerdenken, #denkt, #nachdenken, #querdenken oder #selbstdenker.
Zuletzt wollen wir die Tweets, die #selberdenken verwenden, in ihrer zeitlichen Frequenz darstellen. Hierfür zählen wir die Daten jährlich sowie monatlich und plotten auf der x-Achse die Zeit und auf der y-Achse die Häufigkeit der Tweets in den Datensätzen.
In der Gesamtschau der Tweet-Frequenz, der zusammengefügten Datensätze von 2009 bis 2022 (Abb. 3), zeigt sich in den Jahren der Corona-Pandemie ein starker Anstieg von Tweets die den #selberdenken verwenden. Zuvor gab es allein im Oktober 2018 ein Hoch. Am 9. Oktober 2018 wurde vor allem ein Tweet eines/einer User:in von weiteren, anderen Twitter-Nutzer:innen mittels der Retweet-Funktion weiterverbreitet. Das hat an diesem einen Tag den Ausschlag hervorgerufen. Der spezifische Tweet im Oktober 2018 griff bereits mediale Thematiken auf, zielend auf Zeitungen und ihre Veröffentlichungen, und bekam hier (siehe Abb. 3) viele Retweets.
In diesem speziellen Tweet geht es um Printmedien und die (#)pressefreiheit. Dies scheint nicht irrelevant zu sein, da sich bereits in dem Zeitraum zehn Jahre vor der Corona-Pandemie längst anzudeuten scheint, dass es beim ‚Selberdenken’ oft um Themen der Medien, Nachrichtendienste oder eine politische Aufladung von Themen geht, welche während der Pandemie wieder reaktiviert wurden. Mit der Corona-Krise in den Jahren 2020 bis April 2022 wird eine deutliche Zunahme in der Verwendung des Hashtags ‚selberdenken’ sichtbar.
Im Corona-Zeitraum vom 3. Januar 2020 bis Ende April 2022 (Abb. 4) sind drei deutliche Höhepunkte bei den Tweet-Aktivitäten zum #selberdenken zu erkennen. Diese fanden in den Monaten April und Dezember 2021 sowie im Februar 2022 statt. Die Spitzen sind auf eine hohe Retweet-Aktivität in den jeweiligen Monaten zurückzuführen. Genauer, die Tweet-Häufigkeit wird angehoben, da die Aktivität auf drei bis fünf Tweets zusammenfällt, die in einem hohen Maße von dennoch unterschiedlichen User:innen wiederholt, also retweetet werden.
Immer wieder kommt es im COVID-19-Zeitraum zu Höhen, wie im Oktober 2020, im Mai 2021 oder im Januar 2022. Ansonsten gibt es im Jahr 2020 eine regelmäßige Verwendung des #selberdenken zwischen 20 bis 30 Hashtags, mit Tagen, an denen der Hashtag gar nicht eingesetzt wird. Eine Häufung des Hashtags nimmt zuletzt ab dem Jahr 2021 und in der Annäherung an die aktuelle Gegenwart zu.
Wie anhand der vorgestellten Daten verdeutlicht wird, erhält der #selberdenken seine Popularität auf Twitter erst mithilfe der Corona-Pandemie. Google Trends ist ein Onlineservice von Google, der Auskunft über die relative Popularität von Suchanfragen in der Suchmaschine gibt. Eine Trendabfrage in der Suchmaschine Google verdeutlicht: nach dem Wort ‚selberdenken’ wurde in Deutschland seit dem Jahr 2004 bis heute allein gelegentlich gesucht (Abfrage 17.01.2023). So schwanken die Suchanfragen zwischen den Werten zehn bis 20 und kamen im Januar 2022 auf drei Eingaben. Auch wenn die Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren sind, da Suchanfragen aggregiert werden, Suchen von wenigen Personen, duplizierte Abfragen oder jene mit Sonderzeichen, von Google Trends herausgefiltert wurden, eine übermäßige Abfrage während der Pandemie lässt sich nicht erkennen. Damit scheint ‚selberdenken’ als Schlagwort in Verbindung mit einem Hashtag primär auf der Ebene der Social-Media-Plattform Twitter zu verbleiben. Es handelt sich um ein im sozial-medialen Raum verwendetes Schlagwort, dem (anders als sehr populäre Hashtags wie #metoo) darüber hinaus keine massenmediale Resonanzverstärkung zuteilwurde.
2.2 Was bedeutet #selberdenken auf Twitter? Eine interpretative Annäherung
Da Hashtags als Teil von Tweets verwendet werden, ist ihr Gebrauch Teil einer öffentlichen Kommunikation, die sich an ein Publikum richtet. Dieses Publikum besteht auf Twitter wesentlich aus den eigenen Followern, also Personen, welche die Beiträge einer anderen Person in ihrem Feed angezeigt bekommen wollen. Durch die Funktion des Retweetens können Beiträge aber auch ein größeres Publikum erreichen. Wer tweetet, positioniert sich demnach als öffentliches Subjekt, das einer Öffentlichkeit (wie klein oder groß sie auch immer sein mag) etwas mitzuteilen hat (Dang-Ahn, Einspänner & Thimm, 2012; Murthy, 2012).
Was bedeutet nun die Kommunikation mittels des Hashtags #selberdenken auf Twitter? Was ist ihr sozialer Sinn? Dazu lassen sich drei Bedeutungsebenen explizieren. ‚Selberdenken’ hebt erstens den eigenständigen Gebrauch kognitiver Kompetenzen hervor. Das implizierte Gegenteil wären Gedanken, die lediglich das Gedankengut anderer reproduzieren. Wer ‚selber’ denkt, denkt nicht fremdbestimmt, sondern autonom. Eine erste Bedeutungsebene des Hashtags ist demnach, dass jemand die Fähigkeit zum Selberdenken für sich reklamiert. Die Mitteilung, die der Tweet ansonsten zum Ausdruck bringt, wird damit als Produkt eigenständigen Denkens gerahmt.
Damit wird der Sinngehalt der Kommunikation stark mit dem kommunizierenden Subjekt selbst verknüpft und damit individualisiert. Das ist durchaus nicht bei jeder Kommunikation der Fall. Eine Mitteilung kann die Rolle des Sprechenden bewusst herunterspielen und diesen z. B. als Boten und Überbringer der Mitteilungen anderer aufstellen. Auch ist es denkbar, dass eine Mitteilung ihre:n Urheber:in gar nicht erkennbar macht: Ein Hinweisschild soll typischerweise lediglich eine sachliche Information vermitteln und die Leser:innen interessieren sich nur in Ausnahmefällen dafür, wer das Schild geschrieben oder angebracht hat. Die mediale Kommunikationsarchitektur von Twitter funktioniert jedoch zunächst grundsätzlich anders: Jeder Tweet ist personal zurechenbar, auch Retweets verweisen auf eine ursprüngliche Autorschaft. Wenn Autor:innen ein ‚selberdenken’ für sich in Anspruch nehmen, schärft dies eine soziale Markierung gegenüber Anderen. Man markiert damit in der Sozialdimension eine Differenz zur Alternative eines ‚Fremddenkens’ und bringt damit zum Ausdruck, dass zu dem Thema, um das sich der Tweet dreht, ggf. auch ‚Fremddenkende’ etwas sagen, was zwar ihrer ‚Feder’ entstammt, aber eben nicht ihrem eigenständigen Denken. Diese Unterscheidung von ‚Selberdenkenden’ und ‚Fremddenkenden’ schafft damit zweitens eine epistemische Ungleichheit, die für das Thema der Mitteilung relevant gemacht wird.
Die dritte Bedeutungsebene wird sichtbar, wenn man berücksichtigt, dass #selberdenken eine Mitteilung ist, die sich an Lesende richtet. Das Publikum eines Tweets, der mit dem Hashtag versehen ist, könnte sowohl aus ‚Selber-’ wie auch aus ‚Fremddenkenden’ bestehen. Gegenüber (noch) Fremddenkenden ist der Verweis auf Selberdenken eine Aufforderung zum Seitenwechsel: Man soll die soziale Gruppe der Fremddenkenden verlassen und sich den Selberdenkenden anschließen. Wenn Denken als alltägliche Kompetenz begriffen wird, die man von jedem Menschen erwarten kann, ist auch Selberdenken eine prinzipielle Möglichkeit, die jede:r wahrnehmen kann. Gegenüber (bereits) Selberdenkenden ist der Verweis in sachlicher Hinsicht redundant, in sozialer Hinsicht vergemeinschaftend. Er ist sachlich redundant, da er auf eine kognitive Praxis verweist, die Selberdenkende bereits praktizieren – sie bedürfen dazu nicht der Aufforderung. Mehr noch: Würden sie einfach das reproduzieren, was ein anderer von ihnen erwartet, würden sie gerade nicht von ihrer Autonomie Gebrauch machen. ‚Sei autonom!’ ist eine paradoxe Aufforderung. Die Entparadoxierung ist in der Sozialdimension zu suchen: Wer dieselbe Auffassung zu einem Thema vertritt wie der/die Verfasser:in, kann diese Auffassung nun ebenfalls als Produkt eigenständigen Denkens begreifen: Wer die Auffassung des Sprechenden teilt, kann sich somit zur Gruppe der Selberdenkenden hinzurechnen – und dies ggf. auf Twitter auch kommunikativ durch Kommentare und/oder Retweets zum Ausdruck bringen.
Tatsächlich entspricht der bislang rekonstruierte öffentliche Gebrauch des Hashtags damit der Kantschen Idee der Aufklärung:7
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen (naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein“ (Kant, 2004, S. 5).
Aufklärung ist in diesem Zitat von Kant zunächst 1) ein individualisierender Vorgang, eben der Gebrauch des Verstandes und die Überwindung von „Faulheit und Feigheit“. Er spricht an anderer Stelle demgemäß explizit von den „Selbstdenkende[n]”, die das „Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben“ (Kant, 2004, S. 5). Aufklärung ist 2) aber auch eine normative Erwartung, die man anderen gegenüber hegen und an der man sie messen kann und 3) ein kommunikativer Prozess, der sich darin realisiert, dass jemand die Position des Aufklärers einnimmt und ein komplementäres Gegenüber entwirft, das der Aufklärung bedarf, das also über die Möglichkeit zur Selbstaufklärung informiert wird, mit der normativen Erwartung der Aufklärung konfrontiert wird und zugleich aufgefordert wird, der Erwartung nachzukommen: „Aufklärung ist eine Operation, die man am anderen durchführt“ (Luhmann, 1993, S. 40).
Der soziale Kern der Aufklärung bei Kant ist der öffentliche Gebrauch der Vernunft. Eben dies soll auch der Hashtag #selberdenken zum Ausdruck bringen. Er unterstellt anderen damit, sich (noch?) in einem Zustand der Unmündigkeit zu befinden, da sie als ‚Fremddenkende’ sich ihres eigenen Verstandes eben unter der Anleitung anderer bedienen, statt auf Basis eigenständiger Denkprozesse zu einer autonomen Meinung und Haltung zu gelangen. Im Kontext eines interaktiven Mediums wie Twitter konstruieren ‚Selberdenkende’ damit eine Outgroup, die das Medium zwar ebenfalls nutzt, um öffentlich zu kommunizieren – aber dieses Kommunizieren wird als heteronome Reproduktion der Meinungen anderer dargestellt.
Die vorangegangene Bedeutungsrekonstruktion bezieht sich auf einen affirmativen Gebrauch des Hashtags. Ein kritischer und/oder ironisierender Gebrauch würde sich dadurch auszeichnen, genau jenen zur Schau gestellten aufklärerischen Selbstanspruch zu problematisieren. Eine solche Verwendung eines Hashtags ist – wie auch unsere quantitative Auswertung zeigt – auf Twitter ebenfalls üblich. Sie bezieht sich aber auf einen bereits üblich gewordenen affirmativen Gebrauch und signalisiert eine gewisse Bekanntheit des Hashtags.
Es sollen daher nun drei Tweets betrachtet werden, welche den Hashtag in der eben explizierten affirmativen Bedeutung verwenden und dabei drei unterschiedliche sozio-epistemische Akzentuierungen des Corona-Skeptizismus aufzeigen. Es handelt sich um kontrastive Fälle, die einen zunehmenden Grad an Systemmisstrauen zum Ausdruck bringen, aber zugleich – wie wir zeigen werden – ein vergleichbares strukturelles Kommunikationsmuster aufweisen. Der sequenzanalytischen Interpretationslogik folgend (vgl. Fn. 4) geht es im Folgenden darum, wenig Textmaterial möglichst umfassend auszudeuten, um so grundlegende kommunikative Sinnstrukturen explizieren zu können.
3 Die Kommunikation von Systemmisstrauen
3.1 Alternative Erfahrungen
(2021, 9. Mai). Ich kenne bis heute niemanden persönlich, der oder die an Corona erkrankt oder gestorben wäre.…aber ich kenne immer mehr, die jetzt geimpft wurden...was sagt das über diese Pandemie aus?!? #selberdenken [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/TinaCara1/status/1391310862728765440 [letzter Zugriff am 23.10.2022]
Der erste hier behandelte Tweet beginnt mit folgender Aussage:
„Ich kenne bis heute niemanden persönlich, der oder die an Corona erkrankt oder gestorben wäre.…“
Jemanden persönlich zu kennen, bedeutet, dass man eine Person nicht nur vom Hörensagen oder aus den Massenmedien kennt, sondern ihr im Rahmen einer sozialen Interaktion tatsächlich begegnet ist. Persönliche Bekanntschaft verweist damit auf eine individuelle zwischenmenschliche Erfahrung. Wenn man nun darauf hinweist, dass man niemanden persönlich kennt, „der oder die an Corona erkrankt oder gestorben wäre“ dann spannt man eine Differenz von eigener Erfahrung einerseits und vermitteltem Wissen anderseits auf. Menschen, die von Corona betroffen „wäre[n]“, werden damit der vermittelten Realität zugerechnet – also dem, was man von anderen gehört oder in den Medien gesehen hat. Hier wird nun öffentlich mitgeteilt, dass solche Menschen im eigenen persönlichen, sinnlichen Erfahrungsraum bislang nicht aufgetaucht seien. Kranke und Tote wurden bislang also weder selbst ‚gesehen’ noch wurden persönlich Menschen gekannt, die in der Vergangenheit erkrankt waren und davon erzählt haben.
Damit räumt man zwei bestimmten Evidenzpraktiken8 einen epistemischen Primat ein – a) der Generierung von Evidenz durch die unmittelbare sinnliche Anschauung jenseits medialer Vermittlung und b) dem Vertrauen, das man Personen schenkt, die man persönlich kennt und die einem von ihren Erfahrungen berichten. COVID-19 wird damit als etwas gefasst, das erst durch die persönliche Erfahrung evident wird. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass der/die Verfasser:in des Tweets öffentlich darauf aufmerksam macht, dass Corona in seinem/ihrem persönlichen Erfahrungsraum bislang nicht vorkam. Dadurch werden diese Evidenzpraktiken explizit aufgewertet, während die denkbaren Alternativen implizit abgewertet werden. So artikuliert sich in diesem Tweet ein Misstrauen gegenüber anderen Arten und Weisen der Evidenzgenerierung – von Coronakranken und -toten durch journalistische Medien und/oder professionelle Expert:innen erfahren zu haben. Hier kommt demgemäß ein Vertrauen in die eigenen Sinne sowie ein personalisiertes Vertrauen in konkrete Menschen ebenso zum Ausdruck wie ein Misstrauen in abstrakte Systeme der Informations- und Wissensvermittlung.
Verstärkt kommt dieses Misstrauen durch die „…“ zum Ausdruck, die etwas andeuten, ohne es auszusprechen. Der Verdacht, dass Coronakranke und Coronatote womöglich gar nicht existieren könnten oder zumindest in viel geringerer Zahl vorkommen könnten, als man öffentlich vermittelt bekommt, wird nicht offen ausgesprochen. Vielmehr wird das Publikum durch die ausdrückliche Auslassung dazu angehalten, ‚sich seinen Teil zu denken’ und ggf. selbst zu solchen Folgerungen zu gelangen. Man könnte diese Kommunikation damit als ein öffentliches Einladen zum Systemmisstrauen bezeichnen.
Dies schreibt sich im weiteren Fortgang des Tweets fort:
„aber ich kenne immer mehr, die jetzt geimpft wurden...was sagt das über diese Pandemie aus?!? #selberdenken“
Während an Corona Erkrankte oder Verstorbene im Erfahrungsraum des/der Verfasser:in angeblich nicht vorkommen, tut dies eine andere Menschengruppe sehr wohl: die Geimpften. Dieser Teil des Tweets reproduziert die Strukturlogik der Anfangssequenz damit in spiegelverkehrter Weise. Die Geimpften sind dem/der Verfasser:in persönlich bekannt. Damit differenziert er/sie seinen/ihren Erfahrungsraum in zwei Kategorien von Menschen:9 die erste Kategorie ist die Kategorie der Nicht-Erkrankten lebenden Menschen. Alle Personen, welche der/die Verfasser:in kennt, gehören dieser Kategorie an. Die zweite Kategorie – die Geimpften – ist eine Unterkategorie derselben. Es wird registriert, dass eine wachsende Zahl Gesunder in eben diese Unterkategorie wechselt. Der Tweet spricht wohlgemerkt nicht von Personen, die sich für eine Impfung entschieden haben oder die sich haben impfen lassen. Vielmehr ist „geimpft werden“ etwas, was die Menschen zu Objekten eines Vorgangs macht, der denjenigen widerfahren ist.
Auch in Bezug auf die Bewertung dieses Vorganges belässt es der Tweet bei Andeutungen. Beide Sequenzen zeichnen zusammengenommen jedoch das Bild einer gesunden Bevölkerung, die zunehmend geimpft wird. Nun könnte man meinen, dass diese Beobachtung nicht weiter erwähnenswert und gerade zu erwarten wäre: Wenn COVID-19 (Mitte 2021) immer noch einen vergleichsweise geringen Prozentsatz der Bevölkerung betrifft, zugleich aber eine Impfung bereit steht, die präventiv gegen eine zukünftig mögliche Erkrankung schützen soll, ist der Verlauf, der im Tweet beobachtet wird (gesunde Bevölkerung wird zunehmend geimpft) erwartbar. Zugleich hätte diese Beobachtung ohne weitere Quantifizierung oder Qualifizierung aber keinerlei Nachrichtenwert. Warum sollte man dies öffentlich mitteilen? Der Sinn eines öffentlichen Kundtuns der entsprechenden Beobachtung erschließt sich erst durch das Nicht-Gesagte, durch die Vermutung, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht: Der unausgesprochene aber durch die Mitteilung implizierte Verdacht lautet: Anonyme Systeme (die Medien, die Politik…?) konstruieren erstens eine vermittelte Realität, in der es Coronakranke und Coronatote gibt, während andere anonyme Systeme (die Medizin, die Wirtschaft…?) Menschen impfen. Von hier ausgehend ist es nur noch ein kleiner Schritt zum Verschwörungsnarrativ, dass diejenigen, die eine Pandemie heraufbeschwören und diejenigen, die die Menschen impfen, miteinander im Bunde stehen. Nichts davon steht jedoch explizit in dem Tweet. Er schließt vielmehr mit „?!? #selberdenken“. Durch das Ausrufungszeichen wird Alarm geschlagen, mit den Fragezeichen eine Fragwürdigkeit kommuniziert, zu der keine Antwort formuliert wird. Stattdessen wird die Einladung zum Systemmisstrauen konsequent fortgesetzt. Die Botschaft des Tweets lautet: Ziehe selbst deine Schlussfolgerungen aus diesen, meinen persönlichen Erfahrungen, die ich dir mitteile! Selberdenken wird damit als Aufgabe des adressierten Publikums gerahmt. Man bringt bereits zum Ausdruck, dass man sich selbst zumindest im Prozess des Selberdenkens befindet, in dem man Fragen aufwirft und darauf hinweist, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Selberdenken ist damit bei diesem Tweet keine bloße Aufforderung zur Reflexion. Vielmehr wird die Richtung, in die sich dieses durch den Tweet angeregte Denken bewegen soll, durch Andeutungen vorgezeichnet.
3.2 Alternative Interpretationen
(2020, 6. August). FÄLLT EUCH ETWAS AUF??? Untere Kurve = Verlauf Corona-Tote (wir können sogar Frage “an” und “mit” mal beiseite lassen) Und unsere Regierung verbreitet nach wie vor Angst?? WARUM?? #selberdenken #seid-MSM-skeptisch! #Corona #Maskenpflcht #Lockdown ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-deaths… [Bild angehängt] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/WeCon14/status/1291329017468129283 [letzter Zugriff am 24.10.2022]
„FÄLLT EUCH ETWAS AUF???“ Mit diesem Einleitungssatz wendet sich ein:e Sprecher:in an ein nicht spezifiziertes Publikum, das auf- und wachgerüttelt werden soll. In dem konkreten Fall demonstrieren die gewählten Großbuchstaben schriftlich, was mündlich ein lauter Aufschrei wäre. Twitter wird damit im Sinne eines Megafons genutzt. Aufmerksamkeit soll durch plakative Auffälligkeit erzeugt werden. Der/Die Sprecher:in steht dabei zu seinem/ihrem Publikum nicht in einer sozialen Distanzbeziehung: Die so Angesprochenen werden geduzt.
Statt sich auf formale Hierarchien zu berufen, wird die Differenz von Sprecher:in und Publikum als eine epistemische Differenz gefasst: „Fällt euch etwas auf“ impliziert, dass dem/der Sprechenden bereits etwas aufgefallen ist, dass auch den Angesprochenen ebenso auffallen müsste. Wem etwas auffallen müsste, der müsste eigentlich nur genau hinschauen, müsste nur seine Sinne und seinen Verstand gebrauchen. Die epistemische Differenz von Sprecher:in und Angesprochenen wird somit als etwas gefasst, was zwar praktisch vorliegt aber eigentlich leicht einzuebnen wäre. „Fällt euch etwas auf“ verweist nämlich auf keine tiefgreifende epistemische Differenz von Sprecher:in und Angesprochenen, sondern auf den Gebrauch alltäglicher Kompetenzen, die den so Angesprochenen eigentlich zur Verfügung stehen sollten. Damit werden mögliche Asymmetrien, die epistemisch relevant sein könnten, gleichsam trivialisiert: Wenn es um den ‚richtigen’ Alltagsgebrauch von Verstand und Sinnen geht, können erhaltene Bildungschancen ebenso wenig eine Rolle spielen, wie technische Apparaturen oder kollektive Prozesse der Wissensgenerierung. Die Frage ist zugleich Vorwurf wie Selbsterhöhung: Mir fällt etwas auf, dass dir auch hätte auffallen müssen. Etwas ist eigentlich selbstevident, wenn man nur genau hinschauen würde. Man sagt damit: Ihr habt eigentlich alle epistemischen Mittel in der Hand, um auf meine Ebene des Wissens hinaufzuklettern, aber ihr nutzt sie nicht.
In diesem Tweet wird der Imperativ der Aufklärung – Sapere aude! – in zeitgenössischer Weise mediatisiert und kollektiviert. Angesprochen wird ein unspezifisches Publikum. Eine solche kollektive Adressierung reproduziert die aufklärerische Praxis und Semantik von Protestbewegungen, die auf ein ihnen evident erscheinendes Problem hinweisen und dabei ein breites Publikum anrufen. Ein Tweet bringt solch einen Protest in eine spezifische mediale Form: Eine einzelne Person, die durch Megafonrufe bei einem Protestzug oder massenmediale Kommunikationsformen (wie Flugblätter) adressiert wird, kann die jeweilige Protestbotschaft im Zuge der eigenen Selbstreflexion ignorieren oder akzeptieren (oder sich in der Interaktion mit anderen über die Protestkommunikation austauschen). Eine direkte Interaktion mit demjenigen, der den öffentlichen Protest artikuliert, ist aber in der Regel schwer möglich.10 Bei Twitter verhält sich dies anders. Ein Tweet eröffnet die Möglichkeit, auf ihn zu reagieren. Man kann ihn (1) retweeten und so zum Multiplikator der Botschaft werden oder ihn (2) kommentieren und in eine wechselseitige Kommunikation mit dem/der Sprecher:in eintreten. Die Frage „FÄLLT EUCH ETWAS AUF???“ wird somit von einer rhetorischen Frage zu einer Mitteilung, auf die man antworten könnte. Was aber wäre hier als Antwort überhaupt denkbar? Auf der formalen Ebene liegt eine Entscheidungsfrage vor, welche mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten wäre. Auf pragmatischer Ebene aber wird die befragte Person in eine geradezu unmögliche Position gebracht.11 Antwortet sie mit „nein“ bestätigt sie entweder die implizite These des Fragenden, das ihr etwas Augenfälliges bislang entgangen ist oder sie ist zum Widerspruch gezwungen und bestreitet, dass hier jemandem etwas auffallen müsste. Antwortet sie hingegen mit „ja“ schließt sie sich vordergründig der sozialen Gruppe an, denen etwas auffällt, eröffnet aber hintergründig dennoch die Möglichkeit zum Konflikt mit dem/der Fragesteller:in.
Was einem „auffallen“ soll, wird durch eine Grafik dargestellt. Diese zeigt die steigende Anzahl an COVID-19-Fällen und setzt sie in ein Verhältnis zur Zahl der bestätigten COVID-19-Toten. Die Botschaft ist eindeutig: Trotz einer ständig wachsenden Zahl an Coronafällen steigen die Todeszahlen nicht markant an. Damit verschränkt der Tweet zwei miteinander verschränkte Evidenzpraktiken: Quantifizierung und Visualisierung. Das mit der Pandemie verbundene Risiko wird durch Quantifizierung kalkulierbar gemacht und durch Visualisierung veranschaulicht. Das Publikum soll sehen können, dass von COVID-19 scheinbar keine wesentliche Todesgefahr ausgeht.
Die Grafik stellt scheinbar eine sogenannte Link-Vorschau für die Seite ourworldindata.org dar. Solche Link-Vorschauen werden von vielen Social-Media-Seiten automatisch bei Eingabe einer URL generiert. Das Verlinken von Quellen in sozialen Medien reproduziert eine weitere moderne Evidenzpraxis in derzeitiger mediatisierter Form: das Referenzieren. Man führt einen Beleg für die eigenen Aussagen an und gibt dem Publikum die Möglichkeit, der Referenz zu folgen. Diese Möglichkeit in die Tat umzusetzen war in der vor-digitalen Ära mitunter höchst aufwändig und setzte zumindest den Zugang zu Bibliotheken voraus. Der Hyperlink jedoch reduziert die Nachverfolgung des Beleges auf einen Klick. Grundsätzlich verwandeln Referenzen einzelne Sprecher:innen in Akteur:innen, die nicht nur einfach eine individuelle Meinung verkünden, sondern ein potenziell zweifelndes Publikum auch dazu anhält, nicht nur ihnen als individuelle Person zu widersprechen, sondern zugleich der Spur der Referenzen zu folgen und sich zusätzlich mit diesen auseinanderzusetzen. Referenzen verleihen Autor:innen eine geborgte Autorität (Latour, 1987, S. 31). Die kommunizierte Aussage erscheint damit nicht als eine beliebige Meinung, sondern durch ourworldindata.org belegtes Wissen.
Dieses Berufen auf die epistemische Autorität der Quelle erfolgt nicht bruchlos. Tatsächlich ist die Annahme plausibel, dass es sich gar nicht um eine automatisch generierte Link-Vorschau handelt, sondern um einen bearbeiteten Screenshot der betreffenden Seite, die im Tweet durch den augenfälligen überdimensionierten roten Pfeil ergänzt wurde. Der Pfeil zeigt auf einen Bereich, in dem die (zum Zeitpunkt des Tweets) aktuelle Todeszahl und die Legende („daily confirmed deaths“) zu sehen ist. Der Pfeil zeigt damit überdeutlich auf das, was „auffallen” soll. Er verstärkt damit zum einen die marktschreierische Art und Weise der Mitteilung, zum anderen bringt er visuell das „Selberdenken“ zum Ausdruck. Es wird damit gesagt: Seht her! Ich habe mir diese Quelle angesehen und zeige euch, worauf ihr achten müsst! Es ist doch offensichtlich!
Das, was in der Grafik genau zu sehen ist, wird durch die so visualisierte Aussage der Grafik als selbstevident dargestellt. Daher beinhaltet der Tweet auch keine weitere Begründung und Erläuterung, sondern behandelt das so sichtbar gemachte als unabweisbaren Fakt: „Untere Kurve = Verlauf Corona-Tote (wir können sogar Frage “an” oder “mit” mal beiseite lassen [sic])“. Die von Corona-Skeptiker:innen oft betonte Differenz, ob Personen an oder mit Corona gestorben sind – ob also COVID-19 die eigentliche Todesursache war – kann laut diesem Tweet „beiseite” gelassen werden. Damit wird der doppelte Publikumsbezug des ‚Selberdenkens’ konfirmiert. Die Differenz ‚an/mit’ wird gerade nicht verschwiegen, sie wird vielmehr ausgesprochen. Der Tweet ruft die Differenz auf und markiert damit seine/ihre Zugehörigkeit zum entsprechenden skeptischen Diskurs. Zugleich wird aber betont, dass die diesbezügliche Frage „beiseite“ gelassen werden kann. Er bringt damit gegenüber den vermeintlich Noch-Unaufgeklärten zum Ausdruck, dass die Faktenlage so eindeutig ist, dass man „sogar“ diesen Wissenskonflikt gar nicht mehr führen muss.12
Angesichts dieser angenommenen Evidenz werden die Maßnahmen der Regierung wie folgt thematisiert: „Und unsere Regierung verbreitet weiterhin Angst?? WARUM??“. Der Tweet dokumentiert hier zunächst ein bestimmtes demokratietheoretisches Deutungsmuster, indem er die Regierung als unsere Regierung bezeichnet. Er rechnet sich durch die Verwendung des Possessivpronomens „unsere” selbst einem vergemeinschafteten Kollektiv zu und thematisiert das Verhältnis von Staat und Staatsvolk in spezifischer Weise: Regierungen in Demokratien ‚gehören’ dem Volk, sie müssen dessen Interessen verfolgen. Eine Regierung aber, die Angst verbreitet, gebärdet sich eher wie ein autoritärer Herrscher, der seine Untertanen durch Furcht und Einschüchterung gefügig macht. Denn wer Angst verbreitet, schüchtert nicht eine spezifische Person ein, sondern eine ganze Masse. Und wenn „unsere Regierung“ ohne Not in der eigenen Bevölkerung Angst verbreitet, kann sie im Grunde genommen nicht legitim sein. Das „Selberdenken“ erscheint damit zugleich als eine Antwort demokratischer Staatsbürger:innen auf eine nicht-demokratisch agierende Staatsmacht. Die Bürger:innen sollen sich fragen, warum die Regierung so handelt wie sie handelt, warum sie also in dezisionistischer Manier entgegen eindeutiger Fakten agiert und die Bevölkerung in Angst versetzt. Die Frage nach dem „WARUM“ wird im Tweet selbst nicht beantwortet, vielmehr fordert er dazu auf, dass das Publikum zum öffentlich räsonierenden Publikum wird, dass das Handeln der Autoritäten hinterfragt und nach den Gründen ihres Tuns fahndet.
Neben dem Hashtag „#selberdenken“ schließt der Tweet mit weiteren Hashtags, die einerseits die Selbstpositionierung konkretisieren, andererseits den Vorwurf des ‚Angstverbreitens’ seitens der Regierung kontextualisieren. #lockdown und #maskenpflicht sind Schlagworte, mit denen auf Maßnahmen der Regierung zur Pandemiebekämpfung verwiesen wird. Aufgrund des bisher rekonstruierten sozialen Sinns des Tweets kann die Nennung dieser Maßnahmen hier kaum anders gedeutet werden, denn als einschlägige Beispiele für eine Politik der Masseneinschüchterung. Der (nicht korrekt formatierte) Hashtag „#seid-MSM-skeptisch!“ komplettiert das Bild. MSM kann hier als Abkürzung für Massenmedien verstanden werden. Damit reproduziert der Tweet (wie schon Tweet 1, aber expliziter) einen vertrauten Topos ideologiekritischer Medienkritik: dem Bild der Realität, das von den Massenmedien entworfen wird, sei nicht zu trauen. Der „Realität der Massenmedien“ (Luhmann, 1996) wird das selberdenkende Individuum gegenübergestellt. Konkret werden die Lesenden – ganz im Sinne von „Sapere Aude!“ – dazu aufgefordert, ihr eigenes Urteilsvermögen zu nutzen. Der Tweet ist damit eine Aufforderung zum Systemmisstrauen, die davon ausgeht, dass vorliegende Daten allein richtig beobachtet werden müssten.
3.3 Alternative Quellen
(2021, 18. Dezember). Netzfund [Bild]: Die richtige Antwort lautet nein. Aber das Ziel dieser Scheinregierung ist es eine fünfte Welle zu Produzieren. Die Wahrheit über Omikrom ist im Netz zu finden. Es verhält sich anders, als dem deutschen Volk berichtet wird. #selberdenken [Bild angehängt] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/Gescha23/status/1472123463418748928 [letzter Zugriff am 25.02.2022; dieser Account wurde mittlerweile von Twitter gesperrt]
Der dritte Tweet beginnt mit einem „Netzfund“, also einer Entdeckung, die jemand im Internet gemacht hat. Wenn man einen solchen Fund tweetet, dann teilt man mit, dass das Entdeckte berichtenswert ist. Andere sollen davon erfahren. Damit wird zugleich die Erwartung geweckt, dass man expliziert, was denn das Besondere an dem Fund ist. Wodurch sticht das Entdeckte heraus? Was ist daran mitteilenswert?
Beim hier vorliegenden Netzfund handelt es sich um eine Umfrage des „Tagesspiegels“. Diese lautet: „Frage des Tages: Wird es durch Omikron zu einer fünften Welle kommen?” Die grafisch durch einen nach links oder rechts drehbaren Regler visualisierten Antwortmöglichkeiten lauten „ja“ oder „nein“. Das Publikum wird damit zu einer Form der Partizipation ermuntert, die auf eine binär schematisierte Prognose hinausläuft. Eine komplexe und schwer vorhersagbare Entwicklung, bei der darüber hinaus auch strittig ist, was eine ‚Welle’ eigentlich ist, wann man von einer solchen sprechen kann und auf welcher Grundlage ihr ‚Kommen’ im Vornherein zu erkennen ist, wird in der Frage des Tagesspiegels auf eine ja/nein-Frage („die Frage des Tages”) reduziert, die den Eindruck einer Quizfrage erweckt.
„Die richtige Antwort lautet nein“.
Der Tweet bringt im Umgang mit der Frage eine ironische Medienkritik zum Ausdruck, indem die Antwort so formuliert wird, als wäre man in der Tat Kandidat:in in einer Quizshow. Zugleich verlässt er die Form der reduzierten Partizipation, die durch das journalistische Medium vorstrukturiert ist. Denn statt auf der Website des Tagesspiegels einfach den Regler nach links oder rechts zu schieben, macht er diese binär strukturierte Partizipation in einem anderen Medium – eben auf der Plattform Twitter – zum Thema und artikuliert dort eine Antwort, welche diese Form der Publikumsbeteiligung als gamifizierte Pseudopartizipation entlarven soll. Statt zur Generierung eines Prozentwerts beizutragen und als aggregierter Teil einer Masse unterzugehen, positioniert man sich als autonomes Subjekt, das seine Antwort jenseits des Rahmens artikuliert, der durch den Tagesspiegel vorgegeben wurde.
Es wird somit deutlich, dass der „Netzfund“ ein journalistischer Aufruf zur Massenbeteiligung ist. Dieser wird nicht verlinkt. Das Publikum soll demnach nicht auf die entsprechende Seite des Tagesspiegels geleitet werden. Es handelt sich nicht um eine Referenz. Vielmehr demonstriert der Fund illustrativ etwas, was am zeitgenössischen Journalismus kritisiert werden kann: die Reduktion der Öffentlichkeit auf ein Publikum, dessen Rolle nicht im kritischen Räsonieren, sondern stattdessen im Rezipieren massenmedialer Inhalte besteht (Habermas, 1993). Wenn dann doch einmal die Möglichkeit zum Feedback gegeben wird, dann findet es unter der Kontrolle und Vorstrukturierung massenmedialer Leistungsrollenträger statt. Der/Die Verfasser:in nutzt demgemäß das soziale Medium Twitter um selbst zum Sender zu werden, selbst etwas kundzutun. Nicht der Netzfund selbst ist das Berichtenswerte, sondern das, was der/die Tweet-Verfasser:in dazu zu sagen hat. Diese:r verkehrt die Logik und instrumentalisiert die Umfrage des Tagesspiegels für eine eigene Botschaft:
„Aber das Ziel dieser Scheinregierung ist es eine fünfte Welle zu Produzieren [sic]“.
Damit wird auf den ersten Blick das Thema gewechselt. Es geht nicht mehr um die Umfrage eines journalistischen Mediums, sondern um ein „Ziel“, das von „dieser Scheinregierung” verfolgt wird – und zwar „eine fünfte Welle zu Produzieren [sic]“. Wir erhalten hier die rudimentäre Präsentation einer Verschwörungserzählung. Diese basiert auf folgenden Annahmen: 1. Nicht ein Virus (Omikron) ist die gegenwärtige Ursache für eine mögliche fünfte Welle, sondern ein politischer Akteur (Regierung). Damit ist die fünfte Welle nichts mehr, was der Natur, sondern der Gesellschaft zugerechnet wird: Sie ist nicht etwas, was passieren kann, sondern etwas, das herbeigeführt werden soll. 2. Die Regierung, die die fünfte Welle produzieren will, ist überhaupt keine echte Regierung, sondern eine „Scheinregierung”. Es mag zwar tatsächliche Regierungen geben, aber „diese“ Regierung zählt nicht dazu: Die wahren Machthaber sind demgemäß an anderer Stelle zu finden. Wie ist dieser scheinbare Bruch zwischen ironischer Medienkritik und Verschwörungsmythos zu deuten? Im Zusammenhang gelesen, stellt sich die sequenzielle Folge nicht als abrupter Themensprung dar, sondern als miteinander verbundene Teile einer Verschwörungserzählung – und zwar dann, wenn man Annahme 3 hinzufügt: Die Umfrage des Tagesspiegels gehört zu dem Mitteln, das „Ziel“ zu erreichen, sie ist Teil einer Propagandastrategie. Medien und Scheinregierung arbeiten offenbar Hand in Hand. Wie das „Produzieren“ einer fünften Welle genau aussieht, wird wiederum nicht expliziert. Stattdessen geht der Tweet wie folgt weiter.
„Die Wahrheit über Omikrom [sic] ist im Netz zu finden. Es verhält sich anders, als dem deutschen Volk berichtet wird. #selberdenken“
Die „Wahrheit“, von der hier die Rede ist, hat eine doppelte Gestalt. Zum einen wird davon ausgegangen, dass es die „Wahrheit über Omikron” gibt. Der Wahrheitsbegriff, der hier in Anspruch genommen wird, hat den Charakter einer skandalisierenden Enthüllung, die ohne jeden Zweifel richtig ist. Man findet die Formulierungsweise ‚Die Wahrheit über X’ nicht in seriösen journalistischen Publikationen oder gar wissenschaftlichen Publikationen, sondern eher in der Boulevardpresse (z. B. ‚Die Wahrheit über George Clooney’), in der Werbung für eher zweifelhafte Produkte (z. B. ‚Die Wahrheit über Haarausfall’) oder als aufmerksamkeitsheischender Titel eines Sachbuchs (z. B. ‚die Wahrheit über den Klimawandel’). All diesen Verwendungsweisen ist gemein, dass es sich um die Behauptung einer Wahrheit handelt, die dem Publikum bislang noch unbekannt war und die im Sinne einer eindeutigen Wahrheit (und eben nicht im Sinne wissenschaftlicher Wahrheitsfähigkeit, also nicht als vorläufige und potenziell widerlegbare These) verkündet wird. Eine solche Verkündigung findet hier aber nicht statt. Stattdessen wird das Publikum dazu angehalten, die Wahrheit „im Netz“ zu suchen. Die durch den Tweet Angesprochenen sollen sich auf eine Art informationelle Schatzsuche begeben und ihrerseits einen „Netzfund“ machen, der aber im Kontrast zur Umfrage des Tagesspiegel keine Scheinfragen enthält, sondern echte Antworten liefert. Zum anderen wird davon ausgegangen, dass diese Wahrheit als ein erst „im Netz“ zu findendes Geheimnis von dem abweicht, was „dem deutschen Volk berichtet wird“. Die Lesart einer Verquickung von Medien und Politik bestätigt sich. Man könnte davon ausgehen, dass Berichte über Omikron auf vielfältigen öffentlichen Kanälen und Blättern publik gemacht werden. Diesem Bild einer pluralen journalistischen Medienlandschaft wird hier ein anderes Bild entgegengehalten: von Berichten, die zumindest eines gemeinsam haben: sie alle präsentieren nicht die „Wahrheit über Omikron”. Wenn alle öffentlichen Medien eine „Wahrheit“ nicht thematisieren, dann ist das ohne eine wie auch immer geartete koordinierte Verdunklung kaum denkbar. Nahegelegt wird damit, dass die „Scheinregierung“ (bzw. die „echten“ Machthaber hinter dieser) die „Wahrheit“ gezielt unterdrückt und verschweigt und eine Lüge an ihre Stelle treten lässt. Der Adressat dieser Lüge ist das deutsche Volk, ein politisch vergemeinschaftetes, national gefasstes Kollektivsubjekt.
„#selberdenken“ steht hier also für die Aufforderung zur eigenen investigativen Recherche, welche – wie auch bei den anderen Tweets – durch ein generalisiertes Systemmisstrauen notwendig erscheint. Es wird die Erwartung kommuniziert, dass es alternative Quellen gibt, die erst gefunden werden müssen, damit man zur ‚Wahrheit’ gelangt. Der Akteur eines solchen ‚Selberdenkens’ wäre dann das angeblich belogene deutsche Volk, dass sich dadurch von den Lügen einer angenommenen Scheinregierung befreien könnte.
4 Fazit und Ausblick: Vertrauen in die eigene Erkenntnisfähigkeit, Misstrauen in Systeme
Unser Artikel wollte zum Verständnis der kommunikativen Mikrostrukturen des Corona-Skeptizismus beitragen. Wir haben zeigen können, dass das Berufen auf alternative Erfahrungen, alternative Dateninterpretationen und angeblich existierende alternative Quellen, welche die ‚Wahrheit’ zu COVID-19 offenbaren, als kommunikative Manöver dienen, um Systemmisstrauen zum Ausdruck zu bringen und sich im Gestus der Aufklärung auf einen Primat des individuellen Verstandesgebrauchs berufen. Dabei lädt das Medium Twitter dazu ein, ‚Selberdenken’ lediglich zu behaupten und einzufordern, aber nicht selbst argumentativ auszuführen.13
Die untersuchten Tweets nutzen den Hashtag #selberdenken sowohl als kommunikative Beanspruchung eigener epistemischer Autonomie als auch als eine Aufforderung an andere, sich ihres eigenen Verstandes ohne Anleitung anderer zu bedienen und dadurch eben jene Autonomie ebenfalls zu erlangen. Der epistemische Anspruch, der im #selberdenken verkörpert wird, beruft sich damit auf das moderne Leitmotiv der Aufklärung. Den öffentlichen Positionierungen der Autor:innen ist gemein, dass sie gegen vermeintlich öffentliche Gewissheiten agieren und diesen je eigene Evidenzpraktiken entgegenhalten.
In den Tweets kommt ein Systemmisstrauen zum Ausdruck, das sich insbesondere auf die Massenmedien und ihre Darstellung der gesellschaftlichen Realität und auf staatliche Autoritäten und ihre Eingriffe in die Lebenswelt bezieht. Dem gegenüber wird ein öffentlich räsonierender Skeptizismus gestellt, der sich als Ausdruck individueller Mündigkeit positioniert. #selberdenken reproduziert damit in spezifischer Weise eine Differenzierung von Individuum und Gesellschaft, indem die Autonomie des Individuums gegenüber einer modernen Gesellschaft ausgespielt wird, die Individuen angeblich systematisch belügt. Wer sich in einer solchen Gesellschaft wähnt, kann nur noch dem ‚eigenen’ Urteil vertrauen.
Diese Artikulation von Systemmisstrauen negiert die sozialen Grundlagen von Systemvertrauen. Systemvertrauen wird Luhmann zufolge in der Moderne als sozialer Kitt notwendig, da man immer stärker von Personen abhängig ist, die man nicht kennt, und in Handlungsketten involviert wird, die unüberblickbar geworden sind (Luhmann, 2014). Vertrauen in konkrete Personen reicht in dieser Konstellation nicht mehr aus. Es wird ergänzt durch Systemvertrauen. Beispiele dafür sind das Vertrauen in eine durchsetzungsfähige politische Ordnung, das Vertrauen in einen funktionierenden Zahlungsverkehr oder das Vertrauen in wissenschaftliche Wahrheit. Immer ist mit Systemvertrauen eine Selbstentlastung des Individuums verbunden: Ich vertraue etwa darauf, dass ich mein tagtägliches Überleben nicht mit Gewalt durchsetzen muss oder dass ich niemanden davon überzeugen muss, dass die Banknote mir wirklich den Kauf einer Ware ermöglicht. Ebenso gehe ich nicht davon aus, dass ich wissenschaftliche Fakten immer selbst nachprüfen muss, um ihnen mit Glaubwürdigkeit begegnen zu können (Luhmann, 2014, S. 60–79). „Die Vorleistung des Vertrauenden besteht hier in der unkritischen Verwendung von Informationen, die andere erarbeitet haben. Andererseits ist der Gegenstand des Vertrauens bei funktionaler Autorität [ … ] abstrakt und dadurch ungreifbar. Oft hat man einen authentischen Absender, aber er ist nur die letzte Hand in einer langen Kette der Informationsverarbeitung“ (Luhmann, 2014, S. 68). Systemvertrauen wirkt, weil es latent bleibt. Es wird in der Regel nicht selbst Thema der Kommunikation, sondern ist Teil der Erwartungsstrukturen, welche bestimmte Themen gerade ausschließen. Wer etwa im Gespräch bezweifelt, dass Viren tatsächlich existieren, durchbricht die Routinen der Konsensfiktionen, welche durch die implizite Akzeptanz von Fakten erzeugt wird.
Luhmanns Theorie des Systemvertrauens wurde in den 60er Jahren formuliert. Seitdem haben sich viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens gewandelt – auch und gerade die technologischen Kommunikationsstrukturen. In der „Gesellschaft der Gesellschaft“ greift Luhmann 1997 diesen Punkt im Hinblick auf Expertenautorität explizit auf: „Die moderne Computertechnologie [ … ] greift auch die Autorität der Experten an. Im Prinzip wird in nicht allzu ferner Zukunft jeder die Möglichkeit haben, die Aussagen von Experten wie Ärzten oder Juristen am eigenen Computer zu überprüfen“ (Luhmann, 1997, S. 312). Was Luhmann dabei noch nicht berücksichtigen konnte, war, dass Menschen ihre Computer nicht ausschließlich dazu nutzen, den Aussagen von Expert:innen zu misstrauen, sondern dieses Misstrauen auch öffentlich mithilfe von Computern kommunizieren zu können. Eben dies wird durch soziale Medien in der gesellschaftlichen Breite ermöglicht. Was zuvor meist in den Selbstreflexionen einzelner oder in interaktiven Situationen verblieben wäre, wird durch diese Mediatisierung öffentlich sichtbar und leicht reproduzierbar.14
Hierbei spielt der Gebrauch des Hashtags eine Schlüsselrolle: Der Einsatz von Hashtags ist bereits 2008 auf der Plattform Twitter integriert worden (Van Dijck, 2013). Hashtags machen es einfach, Themengruppen zu bilden, sodass einzelne User:innen zu spezifischen Themen etwas sagen oder sich unter jenen zuordnen können. Mit Hashtags werden Teilnahme und Themensetzung in einem öffentlich-digitalen Diskurs niederschwellig. ‚Selberdenken’ vollzieht sich somit in einem Modus des Selberkommunizierens. Durch die Verschlagwortung mit den entsprechenden Hashtags schaffen sich die jeweiligen Tweets einen Wissens- und Referenzrahmen, der die kommunizierten Äußerungen als Teile eines übergreifenden öffentlichen Diskurszusammenhangs markiert. Gerade die Verknappung des zur Verfügung stehenden Platzes auf 280 Zeichen pro Tweet macht dabei einen Kommunikationsstil attraktiv, der ‚alternative Fakten’ nicht etwa selbst ausführlich plausibilisieren muss, sondern sich auf die Kommunikation vermeintlich selbstevidenter ‚Wahrheiten’, auf starke Thesen, raunende Andeutungen und knappe Aufrufe beschränken kann. ‚Selberdenken’ wird dem Publikum zugemutet, während die Autor:innen – indem sie darauf verzichten, selbst konkret wahrheitsfähige Aussagen zu formulieren, die prüfbar und potentiell widerlegbar wären – keinerlei epistemische Verantwortung übernehmen. Das Programm der Aufklärung wird damit selbst auf ein Schlagwort reduziert.
Die kommunikativen Muster der von uns untersuchten Tweets lassen sich dabei kaum als wissenschaftsförmig im engeren Sinne bezeichnen. Ihnen mangelt es nicht einzig an Belegen oder Argumenten. Vielmehr ist der Stil der Kommunikation ein anderer, er ist unterstellend, polemisierend und skandalisierend. Es überrascht freilich wenig, dass ein Tweet nicht die kommunikativen Merkmale eines Journal-Beitrags oder einer Fachmonografie hat. Wir wollen den Autor:innen der Tweets daher nicht vorwerfen, keine wissenschaftlichen Maßstäbe zu erfüllen. Gleichwohl verweist die Rekonstruktion der kommunikativen Sinnstrukturen auf die Grenzen der aufklärerischen Selbstansprüche, die von den Skeptiker:innen selbst erhoben werden. Der Anspruch epistemischer Autonomie, der im Verweis auf das ‚Selberdenken’ zum Ausdruck kommt, ist selbst problematisch, insofern er Wahrheitsfindung vornehmlich als einen individuellen Prozess darstellt, der sich im eigenständigen Denken von Menschen abspielt. Das kann soziologisch als extreme Trivialisierung von Erkenntnisprozessen begriffen werden. Erkenntnis ist ein sozialer Prozess – darin sind sich die unterschiedlichen Spielarten der Wissenschaftssoziologie einig (Knorr-Cetina, 1984; Latour, 1987; Luhmann, 1998; Merton, 1968). Insbesondere wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn beruht nicht einfach auf dem Selberdenken, sondern auf der Auseinandersetzung mit den Aussagen anderer Autor:innen und auf einer gemeinsamen Arbeit der Forschenden, sei es im Labor oder der hermeneutischen Interpretationswerkstatt. #selberdenken rekurriert hingegen auf ein anachronistisches Ideal heroisch denkender Subjekte.
Es wäre unseres Erachtens soziologisch wenig ertragreich, die kommunikativen Aufklärungsappelle der Corona-Skeptiker:innen einfach als missverstandene Aufklärung zu dekonstruieren und demgemäß eine Aufklärung der Aufklärer:innen einzufordern. Vielmehr besteht unseres Erachtens eine zentrale Rolle der Soziologie weiterhin in einer „Abklärung der Aufklärung“ (Luhmann, 1970, S. 66). Denn Luhmanns These, dass nicht die „angeborene menschliche Fähigkeit“ zur Vernunft oder das „frei diskutierende Publikum“ gesellschaftliche Aufklärung betreiben, sondern eher hochspezialisierte Systeme, die Kommunikationsflüsse auf eine spezifische Weise organisieren (Luhmann, 1970, S. 77), könnte sich auch bei sozialen Medien bestätigen. So zeichnet sich die Wissenschaft eben durch einen organsierten Skeptizimus aus, der einen normierenden und disziplinierenden Charakter hat. Ob von den „Interaktionsarchitekturen“ (Mayer, Muhle & Bock, 2020) sozialer Medien eine solche Ordnungsleistung von epistemischen Konflikten erwartet werden kann, ist fraglich. Statt durch filter bubbles zeichnen sich soziale Medien eher durch filter clashes aus (Pörksen, 2018), in denen vormals getrennte kommunikative Sphären sich begegnen und aufeinander reagieren. Epistemische Konflikte sind so einerseits kaum von politischen, moralisierenden und wertbezogenen Auseinandersetzungen zu differenzieren. Wie sich Konflikte um Wahrheit und Richtigkeit unter solchen Bedingungen vollziehen und welche „Ordnung des Diskurses“ (Foucault, 1974) sich dabei jeweils durchsetzen kann, ist weiter soziologisch auszuleuchten. Dazu konnte auch unsere Untersuchung allein erste Ansatzpunkte liefern. Um die diesbezüglichen Konfliktdynamiken genauer zu erschließen, wären weitere Untersuchungen kommunikativer Anschlüsse an Corona-skeptische Tweets sowie vergleichende Analysen der diesbezüglichen kommunikativen Praktiken auf anderen sozialen Medien notwendig. Zudem weist unsere quantitative Analyse des #selberdenken in die Richtung, dass Hashtag-Verkettungen genutzt wurden und werden, um Themen mit politischen Statements aufzuladen. Auch dem wäre weiter nachzugehen.
Auf Basis unserer Rekonstruktionen konnten wir gleichwohl bereits zeigen, dass in den Positionierungen der ‚Selberdenkenden’ eher ein des-organisierter und individualisierter Skeptizismus zum Ausdruck kommt, der einen erkenntnisorientierten argumentativen Diskurs allein dadurch blockiert, indem er Wahrheit nicht verhandeln will, sondern bereits als hinreichend evident betrachtet. Dieses Vertrauen in die eigene Wahrheit wird komplementiert durch ein grundlegendes Misstrauen in die beobachtete Realität der Massenmedien. Der kommunizierte Verdacht nimmt in den von uns untersuchten Tweets keinen Theoriecharakter an, es handelt sich also nicht um Verschwörungstheorien, sondern vielmehr um angedeutete Versatzstücke von Verschwörungsnarrativen, die auf einen nicht-explizierten Hintergrund verweisen, der von den Leser:innen durch ‚Selberdenken’ ergänzt werden soll.
5 Danksagungen
Für inhaltliches Feedback und die sprachliche Korrektur gilt unser Dank Tobias Schwarz und Michael Kitzing. Wir danken den GutachterInnen und der Redaktion des Journals kommunikation@gesellschaft für ihre wertvollen Hinweise sowie die Unterstützung im Publikationsprozess.
Autor*innenbeiträge
Sascha Dickel und Karolin Kornehl haben das Design des Artikels gemeinsam erstellt. Die quantitative Datenaufbereitung und -auswertung hat Karolin Kornehl übernommen. Sascha Dickel hat die qualitativen Daten ausgewertet. Beide Autor:innen haben zur Interpretation der Ergebnisse beigetragen, das Manuskript vorbereitet und überarbeitet. Der Artikel wurde gemeinsam verfasst.
Datenverfügbarkeit
Alle relevanten Daten befinden sich innerhalb der Veröffentlichung.
Finanzierung
Forschungsgruppe „Evidenzpraktiken in Wissenschaft, Medizin, Technik und Gesellschaft“ (FOR 2448), Teilprojekt „Die De- und Restabilisierung von Evidenz in der Coronakrise“, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 28221085.
Interessenskonfliktstatement
Es liegen keine Interessenkonflikte vor.
Literatur
Bernard, A. (2018). Das Diktat des Hashtags. Über ein Prinzip der aktuellen Debattenbildung. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
Bock, I., Muhle, F. & Mayer, H. (2021). Kommunikative Affordanzen digitaler Medientechnologien. Skizze eines kommunikationstheoretischen Forschungsprogramms zur Analyse der Materialität von Medien. MedienJournal, 45(1), 37–51. https://doi.org/10.24989/medienjournal.v45i1.1915
Bogner, A. (2021). Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Ditzingen: Reclam Verlag, Reihe: [Was bedeutet das alles?].
Boltanski, L. (2010). Soziologie und Sozialkritik. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2008. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bora, A. & Münte, P. (2012). Mikrostrukturen der Governance und die Konstitution regulativer Staatlichkeit: Umrisse eines Forschungsfeldes. In A. Bora & P. Münte (Hrsg.), Mikrostrukturen der Governance (S. 7–28). Baden-Baden: Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845239392-7
Bruns, A. (2019). Filter bubble. Internet Policy Review, 8(4). https://doi.org/10.14763/2019.4.1426
Brüggemann, M., Lörcher, I. & Walter, S. (2020). Post-normal science communication: exploring the blurring boundaries of science and journalism. Journal of Science Communication, 19(3), 1–22. https://doi.org/10.22323/2.19030202
Bucher, H.-J. & Duckwitz, A. (2005). Medien und soziale Konflikte. In M. Jäckel (Hrsg.), Mediensoziologie (S. 179–199). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80675-8‗ 12
Dang-Ahn, M., Einspänner, J. & Thimm, C. (2012). Mediatisierung und Medialität in Social Media: das Diskurssystem. In K. Marx (Hrsg.), Sprache und Kommunikation im technischen Zeitalter. Wieviel Internet (v)erträgt unsere Gesellschaft? (Band 2, S. 68–91). Berlin/Boston: de Gruyter Saur. https://doi.org/10.1515/9783110282184.68
Dolata, U. & Schrape, J.-F. (2014). Kollektives Handeln im Internet. Eine akteurtheoretische Fundierung. Berliner Journal für Soziologie, 24(1), 5–30. https://doi.org/10.1007/s11609-014-0242-y
Dörre, K. (2020). Die Corona-Pandemie – eine Katastrophe mit Sprengkraft. Berliner Journal für Soziologie, 30(2), 165–190. https://doi.org/10.1007/s11609-020-00416-4
Foucault, M. (1974). Die Ordnung des Diskurses: Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. Dezember 1970. München: C. Hanser.
Frei, N. & Nachtwey, O. (2021). Quellen des »Querdenkertums«. Eine politische Soziologie der Corona-Proteste in Baden-Württemberg. Heinrich-Böll-Stiftung. Zugriff am 27.10.2022. Verfügbar unter: https://www.boell-bw.de/sites/default/files/2022-01/Quellen%20des%20Querdenkertums_Frei_Nachtwey.pdf
Frei, N., Schäfer, R. & Nachtwey, O. (2021). Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 34(2), 249–258. https://doi.org/10.1515/fjsb-2021-0021
Gierth, L. & Bromme, R. (2020). Attacking science on social media: How user comments affect perceived trustworthiness and credibility. Public understanding of science (Bristol, England), 29(2), 230–247. https://doi.org/10.1177/0963662519889275
Habermas, J. (1993). Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (Unveränd. Nachdr. 3. Auflage.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hirschauer, S. (2021). Menschen unterscheiden. Grundlinien einer Theorie der Humandifferenzierung. Zeitschrift für Soziologie, 50(3), 155–174. https://doi.org/10.1515/zfsoz-2021-0012
Imhoff, R., Zimmer, F., Klein, O., António, J. H. C., Babinska, M., Bangerter, A. et al. (2022). Conspiracy mentality and political orientation across 26 countries. Nature Human Behaviour, 6(3), 392–403. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01258-7
Kant, I. (2004). Was ist Aufklärung? Zugriff am 27.1.2023. Verfügbar unter: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/159/159_kant.pdf
Keitel, C., Volkmer, M. & Werner, K. (Hrsg.). (2020). Die Corona-Gesellschaft. Analysen zur Lage und Perspektiven für die Zukunft. Bielefeld: transcript.
Knorr-Cetina, K. (1984). Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Könneker, C. (2020). Wissenschaftskommunikation und Social Media: Neue Akteure, Polarisierung und Vertrauen. In J. Schnurr & A. Mäder (Hrsg.), Wissenschaft und Gesellschaft: Ein vertrauensvoller Dialog (S. 25–47). Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59466-7‗ 3
Kumkar, N. C. (2022). Alternative Fakten. Zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung. Berlin: Suhrkamp.
Kurt, R. & Herbrik, R. (2014). Sozialwissenschaftliche Hermeneutik und hermeneutische Wissenssoziologie. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung (S. 473–491). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0‗ 33
Latour, B. (1987). Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Luhmann, N. (1970). Soziologische Aufklärung. In Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme (Band 1, S. 66–91). Opladen: Westdeutscher Verlag.
Luhmann, N. (1993). Über die Funktion der Negation in sinnkonstituierenden Systemen (Soziologische Aufklärung). In Soziales System, Gesellschaft, Organisation (3. Auflage., Band 3, S. 35–49). Opladen: Westdeutscher Verlag.
Luhmann, N. (1996). Die Realität der Massenmedien (2., erw. Auflage.). Opladen: Westdeutscher Verlag.
Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bände. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Luhmann, N. (1998). Die Wissenschaft der Gesellschaft (3. Auflage.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Luhmann, N. (2014). Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität (5. Auflage.). Konstanz: UVK.
Mayer, H., Muhle, F. & Bock, I. (2020). Whiteboxing MAX. Zur äußeren und inneren Interaktionsarchitektur eines virtuellen Agenten (Materiale Textkulturen). In E. Geitz, C. Vater & S. Zimmer-Merkle (Hrsg.), Black Boxes - Versiegelungskontexte und Öffnungsversuche. Interdisziplinäre Perspektiven (S. 295–322). Berlin, Boston: de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110701319-016
Merton, R. K. (1968). Science and Democratic Social Structure. In Social Theory and Social Structure (S. 604–615). New York/London, NY/UK: Free Press.
Murthy, D. (2012). Towards a Sociological Understanding of Social Media: Theorizing Twitter. Sociology, 46(6), 1059–1073. https://doi.org/10.1177/0038038511422553
Oevermann, U. (2002). Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Hermeneutik. Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung. Zugriff am 27.10.2022. Verfügbar unter: http://www.ihsk.de/publikationen/Ulrich_Oevermann-Manifest_der_objektiv_hermeneutischen_Sozialforschung.pdf
Pariser, E. (2011). The filter bubble. What the Internet is hiding from you. New York: Penguin Press.
Pörksen, B. (2018). Die grosse Gereiztheit: Wege aus der kollektiven Erregung (4. Auflage.). München: Carl Hanser Verlag.
Sammet, K. & Erhard, F. (2018). Methodologische Grundlagen und praktische Verfahren der Sequenzanalyse. Eine didaktische Einführung. (Grundlagentexte Methoden). In F. Erhard & K. Sammet (Hrsg.), Sequenzanalyse praktisch (S. 15–71). Weinheim: Beltz Juventa.
Schneider, W. L. (1995). Objektive Hermeneutik als Forschungsmethode der Systemtheorie. Soziale Systeme, 1(1), 135–158.
Sikora, J. (2012). Fragen als Sprechakt. Zur kommunikativen Funktion von Fragen. Studia Germanica Gedanensia, 27, 101–111.
Tsao, S.-F., Chen, H., Tisseverasinghe, T., Yang, Y., Li, L. & Butt, Z. A. (2021). What social media told us in the time of COVID-19: a scoping review. The Lancet Digital Health, 3(3), e175–94. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30315-0
Van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. Oxford, UK: Oxford University Press.
Wehner, J. (1997). Interaktive Medien - Ende der Massenkommunikation? Zeitschrift für Soziologie, 26(2), 96–114.
Weingart, P. & Guenther, L. (2016). Science communication and the issue of trust. Science Communication, 15(5), 1–11.
Welzer, H. (2019). Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand (9. Auflage., Band 19573). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
Wenninger, A. (2015). Hermeneutische Analysen neuer Kommunikationsformen im Internet. In D. Schirmer, N. Sander & A. Wenninger (Hrsg.), Die qualitative Analyse internetbasierter Daten. Methodische Herausforderungen und Potenziale von Online-Medien (S. 51–87). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06296-5‗ 3
Wenninger, A. (2019). Digitale Grenzkämpfe der Wissenschaft. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25298-4
Wernet, A. (2021). Einladung zur objektiven Hermeneutik: Ein Studienbuch für den Einstieg. Leverkusen: UTB; Verlag Barbara Budrich.
Zachmann, K. & Ehlers, S. (2019). Wissen und Begründen: Evidenz als umkämpfte Ressource in der Wissensgesellschaft. Einleitung. In K. Zachmann & S. Ehlers (Hrsg.), Wissen und Begründen: Evidenz als umkämpfte Ressource in der Wissensgesellschaft (S. 9–29). Baden-Baden: Nomos.
Vgl. auch die umfassende sozialpsychologische Studie von Imhoff et al. (2022) zu verschwörungstheoretischen Haltungen und ihrer politischen Positionierung.↩︎
Zur sozialwissenschaftlichen Kritik dieses populären Konzepts vgl. Bruns (2019).↩︎
Weiter ausgearbeitet findet sich diese Kritik an ‚neuen Medien’ in den Arbeiten von Felix Schrape (2011).↩︎
Einen aktuellen Überblick über das von Oevermann entwickelte interpretative Verfahren bieten Sammet & Erhard (2018) und Wernet (2021). Zur Anwendung im Rahmen des Paradigmas der objektiven Hermeneutik vgl. Oevermann (2002), zur wissenssoziologischen Variante vgl. Kurt & Herbrik (2014). Der vorliegende Beitrag stützt sich insbesondere auf die kommunikationstheoretische Ausbuchstabierung der Methode, vgl. Schneider (1995). Zur Anwendung der Methode für digitale Kommunikationsformen vgl. Wenninger (2015).↩︎
Wir haben es hier mit zwei Wörtern zu tun. Den technischen Vorgaben auf Twitter folgend, werden mehrere Wörter, die ein und demselben Hashtag zugeordnet werden, zusammengeschrieben.↩︎
Weitere Schreibweisen waren: #Selberdenken, #SelberDenken, #selberDenken, #SELBERdenken oder #SELBERDENKEN.↩︎
Auch Welzer stellt in seinem Buch „Selber denken“ diesen Bezug zu Kant explizit her (vgl. Welzer, 2019, S. 15).↩︎
Damit sind Verfahren der Herstellung und Darstellungen von Gewissheit gemeint, vgl. Zachmann & Ehlers (2019).↩︎
Zur Kategorisierung von Menschen vgl. grundlegend Hirschauer (2021).↩︎
Kollektive Antworten sind freilich denkbar. Kollektive können sich etwa kritisch durch Buhrufe, spontane Stör- oder Gewaltakte bis hin zu organisierten Gegendemonstrationen artikulieren.↩︎
In der im Anschluss an den Tweet durch Kommentierungen geführten Diskussion, wird darauf hingewiesen, dass die lineare Darstellung das Bild der Todeszahlen verfälscht darstellen würde.↩︎
Wir wollen hier nicht eine Determination von Kommunikation durch Medientechnologien unterstellen. Vielmehr gehen wir davon aus, dass Medien kommunikative Affordanzen generieren. Eine aktuelle Ausdeutung des Konzepts kommunikativer Affordanzen bieten Bock, Muhle & Mayer (2021).↩︎
Zur Kontrastierung unserer Analyse haben wir sowohl die Verwendung des #selberdenken vor der Pandemie als auch seine ironisch-kritische Verwendung untersucht. Dabei zeigte sich, dass der Hashtag auch vor der Pandemie bereits verwendet wurde, um institutionelle Systemkritik zu üben und die eigene, individuelle Rationalität zu überhöhen. Dies zeigt sich etwa an einem Tweet aus dem Jahr 2019, in dem „Politikern“ vorgeworfen wird, „von allen Guten [sic] Geistern verlassen zu sein“ und eine gesellschaftliche Spaltung zu befördern. Dem wird das #selberdenken entgegengestellt. Dabei wird ein Link angeboten, der dem lesenden Publikum die Möglichkeit eröffnen soll, dass ‚Selberdenken’ in die Tat umzusetzen und eigenständig zu recherchieren. Auch hier bleibt der Gebrauch der Vernunft seitens des/der Sprecher:in eine Behauptung, die nicht argumentativ vorgeführt wird. Siehe: (2019, 28. Mai). Von allen Guten Geistern verlassen - und zusätzlich besessen vom diabolischen Geist der Zwietracht und Zersetzung. Typisch unter „hochrangigen“ Politikern in unserer Zeit. #selberdenken https://facebook.com/10001048417697... [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/timkleingarn/status/1133340200074174465 [letzter Zugriff am 24.10.2022]↩︎
0 von Crossref erfasste Zitate
0 von Semantic Scholar erfasste Zitate
Erhalten
Akzeptiert
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenzinformation
Copyright (c) 2023 Sascha Dickel, Karolin Kornehl

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.
Daten zur Förderung
-
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Nummer der Förderung 28221085