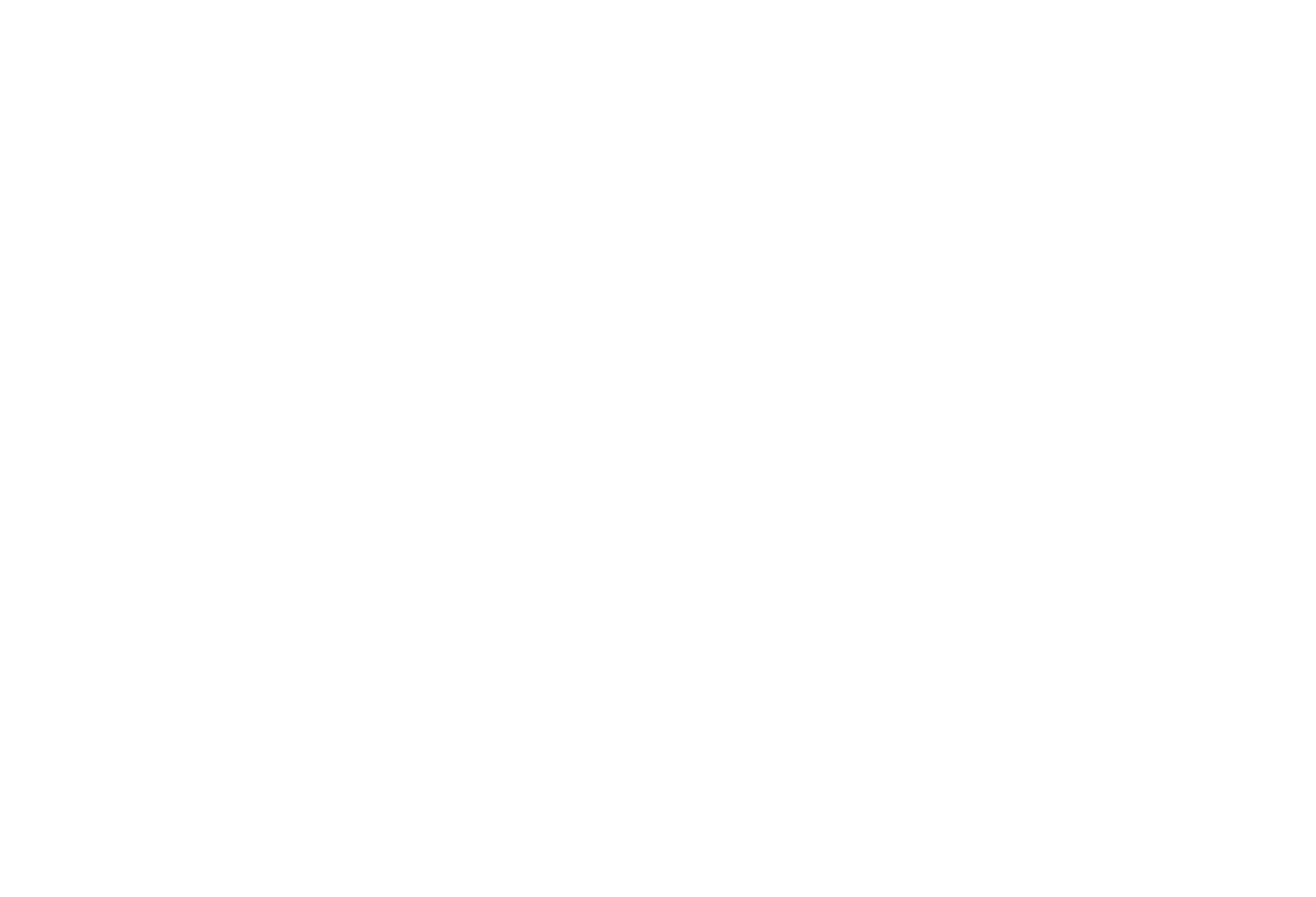Kein Fokus auf das Foto
Fotografieren als Aktivität
DOI:
https://doi.org/10.15460/kommges.2020.21.1.613Schlagworte:
Fotografie, Fotograf, Kreativität, Identität, InteraktionRedaktion und Begutachtung
Abstract
Beim Thema Fotografie steht oft das Resultat an erster Stelle. In diesem Essay hingegen geht es um die Aktivität, das Fotografieren. Warum besitzt diese Aktivität für so viele Menschen einen hohen Stellenwert, selbst, wenn viele Fotos wohl nie wieder betrachtet, bearbeitet oder verwertet werden? Auf Basis teilnehmender Beobachtung, einer Facebook-Umfrage und Interviews ergibt sich, dass das Fotografieren für viele Fotografen das Gefühl von Flow erzeugen, Achtsamkeit fördern und für Kontakt mit der Umwelt und Kommunikation mit anderen Menschen stehen kann. Auch der Jagd- und Sammeltrieb mag befriedigt werden. Zudem bedeutet Fotografieren auch eine Möglichkeit, etwas zu erleben – einerseits, da Erlebnisse durch die fotografische Begleitung mehr Sinn erhalten, andererseits auch, wenn das Fotografieren als Erlebnis selbst begriffen wird. Für die persönliche Entwicklung heißt Fotografieren oftmals neue Sichtweisen, eine neue, besonders befriedigende Art der Wahrnehmung zu erlernen. Außerdem steht es in Verbindung zur Überwindung persönlicher Aversionen und Ängste und bietet auf unkomplizierte Weise Raum für Kreativität. Auch im Dienste der Identität ist Fotografieren von Bedeutung, wenn sich Menschen fotografierend in Situationen begeben, die ihre Identität kommunizieren sollen oder sie durch das Fotografieren ihre Selbstwahrnehmung beeinflussen.
1 Einleitung: Fotografie versus Fotografieren
Geht es um Fotografie, spielt meist das Ergebnis des Prozesses die wichtigste Rolle: In den sozialen Medien werden Fotografien geteilt, in Ausstellungen kann man Fotografien sehen und Fotobücher und -workshops lehren dem Fotobegeisterten, wie man Fotografien am besten aufnimmt, um schließlich ein ansehnliches Resultat präsentieren zu können. Dabei bezeichnet “Fotografie” ebenso den Prozess des Fotografierens selber, die Aktion.
Der Soziologe Thomas Eberle beschreibt introspektiv eine Situation, mit der wohl die meisten Fotografen vertraut sind:
“Meine reflexive Selbstbeobachtung ergab, dass ich lieber neue Fotos schieße als die bisherigen zu selektionieren und in Alben zu gruppieren. Jeden Frühling fotografiere ich in unserem Garten wieder denselben blühenden Kirschbaum, dieselben Blumen und Blüten, Eidechsen und Schmetterlinge. Wäre es nicht klüger, die Zeit dafür zu verwenden, das vorhandene Bildmaterial zu systematisieren und kritisch zu sichten, das Beste auf Photoshop zu bearbeiten und es in geeigneter Form auszustellen und/oder zu publizieren? Denn mittlerweile ist mir längst klar, dass die Vorstellung, nach der Emeritierung die nötige Zeit dazu zu finden, ziemlich illusorisch ist – meine emeritierten Kollegen scheinen nicht mehr Zeit zu haben als vor ihrer Pensionierung. Überdies zeichnet sich ab, dass auch meine Nachkommen kaum Interesse an meinem Fotoarchiv haben werden. Wozu fotografiere ich also? Für die Schublade? Im Zuge meine Reflexionsprozesses erkannte ich die tiefere lebensweltliche Weisheit des ethnomethodologischen Diktums: ‘Consider photographing as an activity in its own right’” (Eberle, 2017, S. 99).
Dieser “Activity in its own right” widme ich mich im Folgenden und nutze zur Abgrenzung die Substantivierung “das Fotografieren”, um die Aktivität von seinem Ergebnis abzugrenzen.
2 Erkenntnisgewinn
Die Basis für den vorliegenden Text stellen zwölf Jahre teilnehmender Beobachtung in der Kultur der inszenierten Menschenfotografie dar, während der ich unterschiedliche Rollen eingenommen habe, die als Modell vor der Kamera, als Fotografin, Workshopleiterin und Journalistin. In meinem Fall verwischen allerdings die Grenzen zwischen dem “Teilnehmen” und dem “Teil sein”. So begreife ich meine eigene Erfahrung primär als einen Zugangspunkt, sie gibt mir ein Gespür für das Thema. Um der Forderung von Katja Mruck und Günther May nach Vielstimmigkeit als Gegenmittel zur subjektiven Verzerrung (Mruck & Mey, 1998, S. 303) möglichst nachzukommen, gebe ich anderen Fotografierenden eine Stimme, indem ich sie in einer Facebook-Umfrage und persönlichen Interviews zu Wort kommen lassen.
Eine offene Frage auf Facebook “Hat das Fotografieren für Euch auch unabhängig von den Bildresultaten einen Wert? Wenn ja welchen?” lieferte erste Erkenntnisse. Nach knapp drei Tagen schloss ich diese Umfrage, zu dem Zeitpunkt hatten 50 Personen die Frage beantwortet, davon 34 Männer und 16 Frauen. Allen war aufgrund meines ersten Kommentars klar, dass ich die Antworten ggf. für eine Untersuchung heranziehe. Zu den 50 Antworten auf die Frage kommen noch drei Antworten, die das Thema verfehlt haben und eben doch auf den Wert der Bildergebnisse eingegangen sind. Ich bin mir bewusst, dass diese Facebook-Umfrage einige Nachteile mit sich bringt, etwa, dass die Betreffenden von vorherigen Antworten beeinflusst werden und nicht ohne Umstände anonym antworten können – wobei auch einige Personen die Frage zum Anlass genommen haben, mir eine private Nachricht zu schicken. Die Umfrage bietet aber auch die Vorteile, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, reflektiert zu antworten und zugleich Statements zu liefern, die ich exakt zitieren kann. Ferner können Likes der jeweiligen Antworten auch Tendenzen aufzeigen. Natürlich kann die erreichte Gruppe nicht völlig repräsentativ sein kann, denn es handelt sich um meine Facebook-Kontakte, also Menschen, die sich tendenziell in ähnlichen fotografischen Genres aufhalten und die social-media-affin sind.
Um noch andere Stimmen zu hören, treten 20 offene, leitfadengestützte face-to-face- und Telefoninterviews hinzu, die ich im Sommer 2019 mit (Hobby-)Fotografen im Alter von 21 bis 73 geführt habe, davon sechs mit Frauen, vierzehn mit Männern. Zwei Interviews fanden jeweils in Zweiergruppen statt, da sich die Treffen so ergeben hatten und Trennungen sehr künstliche Situationen geschaffen hätten. Alle Interviewten waren mir persönlich bekannt, die Interviews fanden möglichst in einem informellen Rahmen statt und ich konnte davon ausgehen, dass ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht, sowie dass die Interviewten auch Interesse an meiner Forschung mitbringen. Für das offene Interview habe ich mich entschieden, um die Personen möglichst wenig von meinen Vorannahmen zu beeinflussen. Acht von ihnen identifizieren sich als “ambitionierte Hobbyfotografen”, drei als “Semi- oder professionelle Fotografen” und neun als “reine” oder “primäre Hobbyfotografen”, ihre bevorzugten Genres reichen von Menschen-, über Reise-, Architektur-, Landschafts- bis hin zur Makrofotografie mit einem gewissen Schwerpunkt auf Reise- und Menschenfotografie – meinen persönlichen Beziehungen geschuldet. Wie auch auf Facebook stieg ich mit der Frage ein, ob sie im Fotografieren auch einen Wert sehen, der nicht in den Bildresultaten besteht. Alle bejahten diese Frage. Ausgehend von dieser Antwort fragte ich nach den Gefühlen während einer für den jeweiligen Interviewten typischen Fotosession. Im Verlauf des Gesprächs ergaben sich meist noch andere Fragen, etwa nach besonderen Erlebnissen. Die Interviews dauerten im Durchschnitt etwa eine Viertelstunde.
Im Folgenden unterscheide ich verschiedene Kategorien, die das Fotografieren zum Wert an sich machen können. Diese Kategorien illustriere ich mit den Aussagen der Fotografen aus den Interviews und der Facebook-Umfrage.
3 Jagen und Sammeln
Betrachten wir aber zunächst den alltäglichen Sprachgebrauch: Zahlreiche Metaphern aus der Jagd werden auf die Aktivität des Fotografieren angewandt, viele davon unabhängig vom fotografischen Genre: Man “pirscht sich an”, “nimmt etwas ins Visier”, “schießt” ein Foto, man “drückt ab”, man “hat es im Kasten”. Dabei scheint nicht nur das Resultat des Jagens interessant zu sein, sondern auch der Vorgang, das Gefühl, auf Jagd zu sein.
Max Weber nutzte für das moderne Leben die Metapher des “rastlosen Jagens […], welches des eigenen Besitzes niemals froh wird, und deshalb gerade bei rein diesseitiger Orientierung des Lebens so sinnlos erscheinen muss” (Weber, 1988, S. 59). Ihm folgend sind wir also in einem ständigen Jagdmodus und das Fotografieren kann diesem eine Richtung geben. Ingrid Thurner konkretisiert dies, indem sie vom Arbeitsmodus spricht, den der Mensch nicht einfach verlassen kann, aber auch Aspekte wie Aggression und Voyeurismus anspricht, was eine ethische Fragestellung einbringt. “A photographer may easily steal what is private” (Beloff, 1983, S. 165) – und das sogar ganz bewußt und willentlich, sollte man hinzufügen. Je nach Motiv kann die Fotojagd tatsächlich ganz konkrete, zerstörerische Komponenten beinhalten. Dies betrifft nicht nur die (heimliche) Menschenfotografie oder die Fotografie von Menschen aus kulturellen Kontexten, in denen man der Fotografie beispielsweise magische Kräfte über den Abgebildeten nachsagt (vgl. z.B. Strother, 2013, S. 177 ff.), sondern auch die Fotografie von Naturschönheiten, die mittlerweile durch zahlreiches Fotografieren arg in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Allerdings mag Jagd, verstanden als ein Grundtrieb im Menschen, im Fotografieren ein zumeist harmloses Ventil finden und zugleich hohe Befriedigung versprechen. Der Psychologe Martin Schuster vergleicht das jagdmäßige Fotografieren mit sexueller Aktivität:
“Der fotografische Akt kennt auch einen Höhepunkt, eine Analogie zur Ejakulation und Orgasmus: das Klicken des Apparats. Bei der Spiegelreflexfotografie ist dieses Klicken sinnigerweise von einem kurzen Moment der Sucherschwärze begleitet (analog zum ‘kleinen Tod’, wie der Orgasmus auch genannt wird). So kommt die fotografische Handlung – mehr als es die Aktmalerei könnte – nicht nur in das assoziative Umfeld sexueller Animation, sondern kann (die innere Bereitschaft des Individuums vorausgesetzt) für den ganzen sexuellen Akt stehen, an dessen Stelle treten” (Schuster, 1996, S. 126).
Tatsächlich findet sich neben der Befriedigung noch eine interessante Parallele der Fotojagd zur sexuellen Aktivität: Beides findet oft ohne den Fokus auf ein unbedingtes Ergebnis einfach für sich selbst statt. Bei beidem geht es, wenn man den Begriff von Besitz einbringen möchte, eher um eine Art imaginären, als um tatsächlichen Besitz. Die Kamera mag hier ein zwischengeschalteter Apparat sein, der dabei hilft, den Moment der Inbesitznahme festzulegen – das Auslösen – während das darauffolgende Besitzen unter Umständen gar nicht so wichtig ist, ein Besitz, der in mehrfacher Weise virtuell ist: Weder gehört einem das Fotografierte tatsächlich, noch kann man den Moment zurückholen, noch ist das Foto (zumindest bei digitalen Daten) “in real life” vorhanden, noch mag dieses Ergebnis überhaupt interessieren. Das Gefühl des Besitzens scheint sich vor allem beim Abdrücken einzustellen und legt dabei vielleicht auch fest, welcher Moment am ehesten erinnert wird, stellt also eine Struktur für die Erinnerung zur Verfügung und damit für das, was oft am meisten “besessen” wird.
In der Facebook-Umfrage bezeichnete eine Person das Fotografieren als ein “Ventil”, ein anderer als “Suche”. Auch in den Interviews fielen die Metapher des Jagens und Sammelns oder damit verbundene Begriffe mit zwei Malen eher selten – dies mag jedoch der sozialen Erwünschtheit geschuldet sein. Gerade im Bereich der Menschen- und Reise- sowie der Porträtfotografie, also Genres, bei denen Interaktion mit Fotografierten eine wichtige Rolle spielt, möchte man sich vom “Abschießen” distanzieren. Allerdings erwähnten neun der Antwortenden, dass das Fotografieren für sie eine aufregende Komponente beinhaltet. Die Begriffe “Action” und “Spannung” fielen in diesem Kontext, sowie “Erleichterung”, wenn das Bild gebannt ist.
4 Flow und Achtsamkeit
“Wenn ich fotografiere, bin ich meist angespannt, ich bin hellwach und fokussiert. In diesem Modus erkunde ich meine unmittelbare Umwelt im Großen wie im Kleinen” (Knoblauch, 2017, S. 99)(Eberle 2016: 99). Der von Eberle beschriebene und von einem Großteil der Interviewten ebenfalls mit verschiedenen Worten wie “mittendrin/voll dabei oder fokussiert sein” erwähnte Zustand erinnert an “Flow”. Dieser Begriff, geprägt von Mihály Csíkszentmihályi (1975) bezeichnet eine besondere Form der intrinsischen Motivation, “ein freudevolles Aktivitätsgefühl, in dem man völlig in der Sache, mit der man sich beschäftigt, aufgeht. Dabei wird die gesamte Aufmerksamkeit und das gesamte Denken von dieser Tätigkeit absorbiert; man vergisst Zeit und Umgebung” (Fischer & Wiswede, 2009, S. 100). Für das Erleben von Flow ist es wichtig, dass die Tätigkeit weder über- noch unterfordert. Das Fotografieren kann diese Balance besonders gut bieten: Die Aktivität selbst ist nicht sonderlich kompliziert, und durch die Suche neuer Fotomotive, neuer Lichteinstellung etc. kann man sie leicht so anpassen, dass sie das individuell passende Maß an Forderung mitbringt, unter Umständen je nach Fähigkeit des Fotografierenden auch äußerst anspruchsvoll werden kann.
Eberle bringt das Fotografieren mit einem besonderen kognitiven Stil in Verbindung und spricht mit Henri Bergson und Alfred Schütz von der “Attention à la vie” (Eberle, 2017, S. 100). Fotografie schult zur “Wahrnehmung auch für Details, für kleine Dinge” (Hofmann, 2005, S. 187). Hier scheint das Konzept der Achtsamkeit aus der Psychologie anzuknüpfen: “Achtsamkeit ist ein Prozess, bei dem die Aufmerksamkeit nicht-wertend auf den gegenwärtigen Augenblick gerichtet ist” (Anderssen-Reuster, 2011, S. 1), oder, noch optimistischer formuliert: “Mindfulness is essentially about waking up to what the present moment offers” (Brown, Ryan & Creswell, 2007, S. 272 , zur Abgrenzung zu Self-Awareness vgl. S. 273). Mit einem gewissen Abstand soll ein einerseits nüchternerer Blick, zugleich aber auch annehmender Blick gelingen. “Der Akt des Fotografierens (ist) mehr als nur passives Beobachten, […] ist […] eine Form der Zustimmung” (1980: 18) formuliert Susan Sontag, durchaus in einem kritischeren Kontext, allerdings passt es eben auch auf positive Aspekte: Mit einer inneren Offenheit die Umwelt wahr- und damit auch anzunehmen, ohne gleich zu werten und nach Verwendbarkeit zu sortieren, kann auch dazu führen, das sonst Übersehene wahrzunehmen, ihm Aufmerksamkeit zu schenken oder Besonderheiten, Farbkombinationen, Formen oder Muster zu entdecken, verbunden mit Freude über diese Entdeckungen. Die relativistische Komponente hierin lässt sich mit der Suche nach Fotomodellen illustrieren: Eigene Präferenzen, die beispielsweise bei der Partnerwahl eine Rolle spielen, treten hier oft in den Hintergrund zugunsten von Aspekten, die visuell interessant sein können.
In der Umfrage auf Facebook wurden zahlreiche Begriffe genannt, die mit Flow und/oder Achtsamkeit in Verbindung gebracht werden können, darunter fielen beispielsweise folgende Wendungen: Fotografieren hilft beim “Abschalten, Runterkommen”, “wenn ich fotografiere, vergesse ich die negativen Sachen”, “für mich ist es Entspannung”, “Heilung und Entspannung”, “es entschleunigt enorm” oder “es ist wie Wellness” und “es ist meditativ”. Einige Aussagen erinnern an Bourdieus Feststellung, Fotografie eigne sich als Flucht aus dem Alltag, die Menschen erlaubt, “in der fotografischen Praxis das Bedürfnis nach Eskapismus auszuleben und so den Anforderungen der Realität für einige Zeit zu entkommen” (Berger, 2010, S. 2). Auch der Begriff “Flow” fand in der Umfrage Erwähnung. Bisweilen wurde das Gefühl der Absorbtion auch umschrieben: “Ich würde, glaub ich, nicht mal merken, wenn man mir (dabei) die Kleidung vom Körper klaut”. Identische Begriffe und ähnliche Beschreibungen fielen in den Interviews, darunter ebenfalls mehrfach der Begriff “Flow”, wobei meine Nachfragen suggerieren, dass er tatsächlich im o.g. Sinne gemeint war.
5 Interaktion
5.1 Verbindung zur Umwelt und Natur
Fotografieren ist eine Art, mit der Welt in Kontakt zu treten – dies beginnt schon, wenn man ein Set für die Fotografie aufbaut oder das Haus verlässt, um zu fotografieren: Man widmet sich der Welt, dem, was außerhalb der eigenen Person liegt. Das trifft sogar im Falle von Selbstporträts zu, da man sich auch hier in eine äußere Position versetzen muss, um sich selbst zu betrachten. Da Fotografie immer auf etwas in der Welt befindliches rekurriert, immer eine indexikalische Komponente beinhaltet, bedeutet Fotografie stets die Auseinandersetzung mit der Welt.
Einige Teilnehmer der Umfrage auf Facebook und mittels des Leitfadens Interviewte nennen dabei spezifisch die Interaktion mit der Natur, umschrieben mit Wendungen wie “Natur, Welt genießen”, “an der frischen Luft sein” oder direkt mit “Interaktion mit Mensch und Natur”. “Woher stammt diese Sehnsucht nach Natur?” fragen sich Kirchhoff, et al. (2012)? “Eine typische Antwort auf diese Frage(n) lautet, Sehnsucht nach Natur sei eine Reaktion auf die als zunehmend naturfern empfundenen Lebensbedingungen unserer modernen Zivilisation […] Natur als authentische Gegenerfahrung […] Diese Antwort ist allerdings unbefriedigend. Sie basiert nämlich auf der fragwürdigen ontologischen These, dass es ein natürliches menschliches Grundbedürfnis nach Natur gebe” (ebda., 10). Kirchhoff et al. nennen zwei Gründe für die Sehnsucht nach der Natur: Menschen mögen es, Zeit in der Natur zu verbringen, weil es ihre mentale und physische Gesundheit fördert, und Natur ist im sogenannten “westlichen” kulturellen Kontext positiv besetzt (vgl. Kirchhoff, Vicenzotti & Voigt, 2012, S. 11), eine Tatsache, die keineswegs selbstverständlich ist: Natur könnte auch als einschüchternd und gefährlich betrachtet werden. Tatsächlich zeigt der Blick in die Geschichte, dass wilde Natur keineswegs immer als wertvoll angesehen wurde. Die Ära des Romantizismus gerät hier in den Fokus, verstanden als eine Gegenbewegung zum Klassizismus, der klare Linien betonte – korrespondierend zur Aufklärung, in der die Welt entzaubert wurde. Dementgegen feierte der Romantizismus die unbezähmbare Natur. “Mit der wachsenden Herrschaft über die Natur wurde es zunehmend möglich, eine bislang als feindlich oder abweisend empfundene Umwelt als ästhetische ‘Landschaft’ zu genießen; Gebirgsformationen dienten als Projektionsflächen, um die Erfahrung der Bedrohlichkeit zu einer Ästhetik des angenehmen Schauderns umzuwerten” (Stampfli-Marzaroli, 2003, S. 14) und in Folge wurden auch “eingerahmte” Landschaften, Gemälde populär. Der Romantizismus scheint in den folgenden Epochen nachzuwirken: Als die Industrialisierung sich ihren Weg bahnte und die Urbanisierung aufkam, blieb die Natur als Ort der Romantik und Nostalgie. Heute zeigen Bewegungen wie “Fridays for Future” auch in politischer Hinsicht den Wert der Natur. Beim Fotografieren geschieht die Interaktion mit der Landschaft auf unterschiedliche Weise: Man begibt sich nach draußen in die Natur, erlebt sie und gestaltet ihren Anblick durch den Bildausschnitt, die Perspektive, den Zeitpunkt etc., aber auch durch aktives Einwirken auf die Landschaft, etwa die Bereinigung von das Bild störenden Blättern, Zweigen und Steinen, durch die Integration eines Models oder das Anlocken eines Tieres.
5.2 Kommunikation
Den Faktor “Kommunikation” nennt schon Pierre Bourdieu in seinem Beitrag über die Befriedigung, welche durch das Aufnehmen, Aufbewahren und Anschauen von Fotografieren erlebt werden kann (Bourdieu, 2006, S. 31). Kommunikation betont die Komponente des Austauschs, der Gegenseitigkeit und wird daher besonders relevant, wenn Menschen fotografiert werden. Kommunikation kann auf unterschiedliche Weise stattfinden, etwa, indem Fotografierte bezahlt werden oder indem sich durch den Anlass der Fotografie ein kleines Gespräch ergibt. Dabei sind unterschiedliche kulturelle Dispositionen und individuelle Eigenschaften von Bedeutung: Vor allem im südasiatischen Bereich fühlen sich Menschen, die für ein Foto ausgewählt werden, oft gewürdigt, während dies in nordafrikanischen Regionen aufgrund der islamischen Bilderskepsis (vgl. z.B. Naef & Seiler, 2007, S. 118) meist weniger der Fall ist. Manche Individuen fühlen sich eher geschmeichelt, andere verlegen oder unangenehm und je nach Tagesform freut man sich oder lehnt das Fotoangebot ab. Neben der Reise- oder Street-Fotografie besteht besonders bei der inszenierten Menschenfotografie oder (Hobby-)Modelfotografie die Notwendigkeit zur Kommunikation. Die betreffenden Parteien müssen dann ihre Wünsche und Ideen dem Gegenüber klarmachen, die zu zeigenden Situationen und Emotionen müssen für die Gesprächspartner fassbar sein, um ästhetische Mittel auszuwählen, die sie angemessen transportieren: “Dadurch wird die Emotion gewissermaßen ent-emotionalisiert. Etwas Inneres, eine Emotion, die für mindestens eines der Team-Mitglieder wichtig genug war, um sie als Thema einzubringen, wird von innen nach außen gebracht, indem man sich überlegt, wie das Gefühl in ein zweidimensionales, statisches Bild zu überführen ist” (Jerrentrup, 2018, S. 43). Eine gewisse Rationalisierung ist notwendig, die Übernahme einer anderen Perspektive. So werden Emotionen “sichtbar und dadurch zu einem anschaubaren Gegenüber, das Möglichkeiten der Distanzierung und Veränderung einschließt. Ein nach außen projiziertes und symbolisiertes psychisches Geschehen vermag seine Bedrohung zu verlieren” (Mechler-Schönach, 2005, S. 15). Damit steht der Aspekt “Kommunikation” auch im Zusammenhang mit persönlicher Entwicklung. Ein weiteres Beispiel, das dies verdeutlicht, ist die Notwendigkeit eines Mindestmaßes an Empathie (vgl. Jerrentrup, 2018, S. 105) als Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation – dies wurde auch von einer Person in der Umfrage reflektiert, die schrieb: “Es (= das Fotografieren) schult meine Empathie”.
Die Verbindung zu anderen Menschen war für Dreiviertel der Interviewten ein wichtiger Aspekt beim Fotografieren, zwei von zwanzig hingegen sagten, sie erlebten das Fotografieren “ganz für sich”. Bei der Umfrage auf Facebook war Kommunikation, bezeichnet als “neue Leute (Freunde) kennenlernen”, “Menschen kennenlernen”, “mit Menschen ins Gespräch kommen” etc. der am meisten genannte Aspekt. Häufiger fand dabei auch der Begriff “Freundschaft” Erwähnung. Wie eingangs bemerkt, mag dies aber auch daran liegen, dass meine Kontakte primär Menschenfotografen sind und dass Fotoaffine, die in den sozialen Medien auf so eine Frage antworten, vielleicht ohnehin besonders kontaktfreudig sind.
6 Erlebnis “Fotografieren”
6.1 Fotografische Begleitung von Erlebnissen
Betrachten wir zunächst die Begleitung von Erlebnissen durch die Fotografie. Kristin Diehl und Gal Zauberman gehen in einer empirischen Studie der Frage nach, ob Fotografie den Genuss von Erlebnissen stärkt. Im Experiment sollten Menschen einmal mit Kamera und einmal ohne an einer ansonsten identischen Stadtrundfahrt teilnehmen. Tatsächlich fanden die Forscher heraus, dass Fotografie den Genuss positiver Erfahrungen fördert. Dies ist der Fall, wenn die Fotografie die Betreffenden stärker involviert und weniger wahrscheinlich, sofern die Erfahrung selbst schon fordernd ist (vgl. Diehl und Zauberman 2016), was wiederum dem bereits genannten Phänomen des “Flow” entspricht. Dabei wird auch implizit deutlich, dass Fotografieren sich hervorragend als “Begleitbeschäftigung” anbietet, was wiederum zu der Vielfalt an Möglichkeiten, die sich mit ihr eröffnen, beiträgt. Dieser Aspekt wurde in der Umfrage von einen Betreffenden so umschrieben: Ich finde “das Fotografieren schon deswegen wertvoll, weil es in seiner Universalität einzigartig ist”. Dabei besteht ein fließender Übergang zwischen der fotografischen Begleitung und dem folgenden Punkt, der Suche nach Erlebnissen extra für das Fotografieren.
6.2 Erlebnisse für das Fotografieren
Ingrid Thurner betrachtet, wie das Fotografieren selbst Erlebnisse mit sich bringt: Es “macht aus dem Erlebnis Wirklichkeit. Man würde sich nicht mitten in eine Horde Kinder stellen, an jeder Hand eines haltend, wenn man sich nicht fotografieren ließe. Man würde nicht den Arm um zwei völlig Unbekannte, fotogen Gekleidete legen, die sich als haupt- oder nebenberuflich tätige Fotomotive verdingen” (Thurner, 1992, S. 31). Thurner schließt desillusioniert: “Es wird nicht dokumentiert, was man erlebt hat, sondern man erlebt es nur, weil man es dokumentiert” (Thurner, 1992, S. 31).
Wie bereits bei Thurner anklingt, lässt sich daraus ein Geschäft machen: Schon seit langem haben Menschen in Urlaubsdestinationen erkannt, dass sie pittoresk in der Tracht des Ortes gekleidet, vielleicht noch tanzend oder traditionellem Handwerk nachgehend als Fotomodel Geld verdienen können. Gegebenenfalls werden Trachten, Tänze etc. zu diesem Zweck noch so modifiziert, dass sie den Geschmack der Touristen besser treffen: Eine Pseudoauthentizität wird kreiert. Kritik an dieser Praxis verkennt dabei allerdings oft, dass dies die einheimische Wirtschaft fördert, gerade auch, wenn entsprechende Fotos dann in den sozialen Medien zirkulieren. Zudem wird dadurch sicher die ein oder andere totgesagte Tracht oder Kunst in Teilen bewahrt oder zumindest eine Basis für eine neue kulturelle Entwicklung, ggf. auch Neuschöpfungen (vgl. Thurner, 1992, S. 226) geschaffen. Vergleichbar ist hier die Airport Art, Kunst, die traditionell inspiriert ist, aber an den Touristengeschmack und ans Kofferformat angepasst wird. Ihr Ziel ist neben dem Verdienst durchaus auch der Transport von Information über die Kultur (vgl. Rubinkowska-Aniol, 2017, S. 124) – aus dem Erlebnis für das Fotografieren kann ein tatsächlicher Austausch, eine tatsächliche Beschäftigung mit dem Fotografierten entstehen.
Mittlerweile werden auch spezifische Erlebnisse zum Fotografieren im Sinne des Selbstporträtierens geschaffen. So sieht man zum Beispiel zu bezahlende “Selfie-Spots” mit besonders gestalteten Schaukeln auf Bali oder Sänften und altchinesische Kostüme für Touristen und Passanten in der Innenstadt von Souzhou. In Köln hatte von Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 das nach amerikanischem Vorbild gestaltete Supercandy Popup Museum seine Tore geöffnet, in dem man sich selbst fotografieren oder in mehr oder minder professionellen Fotoshootings inszenieren lassen konnte. Das Teilen der Fotos in den sozialen Medien wurde ausdrücklich erwünscht, war Teil des Marketingkonzepts.
Auch Shootings in der Szene der inszenierten Menschenfotografie stellen Erlebnisse dar, die speziell für die Fotografie stattfinden: Modelle, Fotografen, Visagisten, Stylisten und Assistenten klettern hierfür auf Felsen, erkunden die Natur in ihrer Gegend, reisen an ferne Locations oder kreieren skurrile Verkleidungen. Viele Fotoaffine erleben auf diese Weise einen Einblick in andere Lebensweisen oder einen Eindruck von Orten, die ihnen sonst völlig fremd geblieben wären. Das Fotografieren motiviert sie zu solchen Erlebnissen. Dies entspricht der Praxis des Bilderteilens in den sozialen Medien: “Youngsters appear to take less interest in sharing photographs as objects than in sharing them as experiences” (Dijck, 2008, S. 61). Van Dijck bezieht sich hier auf “Youngsters” und, so könnte man schließen, damit auch auf die Tendenz zur Immaterialität einer Generation, der es materiell an nichts fehlt.
Zwar wird natürlich vieles dabei nicht vertieft kennengelernt, aber man begibt sich zum Fotografieren und Fotografiertwerden doch “in” die Situation (vgl. Jerrentrup, 2018, S. 96), eine Erlebnisqualität, die sich von der reinen Rezeption unterscheidet. Fast alle Interviewten gingen auf diesen Aspekt ein, viele brachten Beispiele aus ihren eigenen Erfahrungen. Ein Interviewter sagte, durch den “Vorwand des Fotografierens” habe er eine Möglichkeit gefunden, sich im Urlaub von den Touristenpfaden zu entfernen. Andere bemerkten, sie haben durch das Fotografieren neue kulturelle Kontexte wie die der Cosplayer, LARPer, der Fashion-Szene, des Shibari oder des Rennfahrens kennengelernt. In der Umfrage nannten etwa ein Fünftel explizit den Aspekt, Neues kennenzulernen, implizit mag man ihn auch in der besonders häufig erwähnten interaktiven Komponente lesen.
In ihrem kritischen Aufsatz bemängelt Thurner, dass das Fotografieren bisweilen die Stelle des Erlebens einnehme, dass statt des Erlebens ein Foto gemacht wird (Thurner, 1992, S. 32). Ihrem Gedanken folgend kann man davon ausgehen, dass das Fotografieren “anstelle des Erlebens” mehrere Aufgaben erfüllt: Es hilft dabei, Erlebnisse in Häppchen zu strukturieren, der Aufmerksamkeit angesichts einer Menge von Eindrücken eine Richtung und Aufgabe zu geben und mit der Kamera in der Hand die eigene Rolle zu verdeutlichen, damit auch einen gewissen Abstand zum Erlebten zu signalisieren – psychologische Funktionen, die für das Individuum durchaus notwendig sein können. Dies wurde allerdings von keinem der Umfrageteilnehmer oder Interviewten thematisiert.
7 Fotografieren als persönliche Entwicklung und Entfaltung
7.1 Fotografieren als Sehen lernen
Unabhängig von der Technik bringt uns die Kamera dazu, auf andere Aspekte zu achten, neue Perspektiven zu finden, kurz, sie prägt die Wahrnehmung und kann, wie oben erwähnt, Achtsamkeit fördern. Technikinhärent gehört hierzu der Fakt, dass sie einen Rahmung bereithält: Nur begrenzte Information passt auf ein Bild. Hinzu kommen unterschiedliche Brennweiten, die uns in unserer Alltagswahrnehmung nicht allesamt geläufig sind und uns unsere Umgebung anders wahrnehmen lassen, ein anderes Erleben des Fokusses, so dass wir beispielsweise Bokeheffekte sehen können und im Falle digitaler Fotografie lassen sich leicht besondere Weißabgleiche wählen oder direkt im Sucher andere Farbwelten – schwarz-weiß oder cross-processed etwa – erleben.
Die Kamera illustriert gleichsam, dass man die Dinge auch anders sehen kann und das Fotografieren, das auch immer wieder ein Spiel mit den technischen Möglichkeiten darstellt, zeigt uns neue Ansichten. Die Kamera ist so gesehen ein relativistischer Apparat, der durch diese Eigenschaft unser Wissen erweitert. “Selbst das deutsche ‘Wissen’ leitet sich vom lateinischen Sehen, ‘videre’ ab” (Knoblauch, 2017, S. 367) – das Fotografieren lässt uns wissen, dass es noch viel mehr zu sehen gibt, obgleich all das nicht durch Fotografien festzuhalten wäre.
Dabei transzendiert das Fotografieren die tatsächliche Aktion: “Immer wieder sehe ich auch Bilder, bei denen ich aufgrund meines fototechnischen Wissens sogleich erkenne, dass daraus niemals ein gutes Foto entstehen könnte und ich sie demnach ausschließlich als ‘innere Bilder’ genießen muss” (Eberle, 2017, S. 107). Man hält mit dem fotografischen Blick Erinnerungen fest, als würde man fotografieren – selbst wenn die Aktion nicht geschieht. Dies stellt sich zunächst vor allem dann ein, wenn man mit Kamera unterwegs ist. Ich erinnere mich an konkrete Bilder vor meinen Augen während einer Busfahrt durch Indien – tolle Motive, aber ich wusste, dass ich sie, obwohl ich meine Kamera um den Hals hatte, aus dem holprigen Bus mit den abgedunkelten Scheiben nicht vernünftig festhalten kann. Dennoch sind mir gerade diese Bilder am besten im Gedächtnis geblieben.
Doch auch ohne die Kamera griffbereit zu haben, gewissermaßen “im Fotomodus” zu sein, mag die fotografische Gewohnheit das Sehen schulen. “Seit ich fotografiere, sehe ich anders”, brachte es eine der Interviewten auf den Punkt, man kann “dadurch eine ganz besondere Weitsicht erlangen” und “Bewusstseinserweiterung”, formulierten Teilnehmer der Umfrage.
7.2 Überwindung
Fotografie kann, wie bereits festgehalten, einerseits dazu motivieren, in Hinsichten aktiv zu werden, für die es ansonsten weniger Anlass gäbe, andererseits auch etwas zu unternehmen, das man sonst aus mangelndem Interesse, anderer Priorisierung oder gar emotionaler Abneigung nicht in Erwägung ziehen würde, für das man über sich selbst hinauswachsen muss. Bei einem meiner Shootings beispielsweise bat ich das Hobbymodel, auf einen Baum zu klettern. Genau für solche Momente liebe sie die Fotografie, sagte sie später. Mit ihrer ausgeprägten Höhenangst, von der ich nichts gewusst hatte, würde sie sich sonst niemals zu so etwas überwinden, aber mit dem Gedanken, es sei “für ein höheres Ziel” falle es ihr verhältnismäßig leicht. Ähnliche Beispiele brachten in den Interviews etwa ein Drittel der Befragten. In der Umfrage kann man Statements wie “Ich gehe dafür an meine Grenzen” oder “Egal ob nun das Foto gelungen ist oder nicht, wichtig ist meiner Meinung nach, dass man sich dafür bewegt hat” in diese Richtung interpretieren.
Die Motivation, Grenzen zu überwinden, über sich hinaus zu wachsen, liegt darin, im Fotografieren einen höheren Wert zu sehen, der gewisse “Opfer” erfordert. Dies kann auch im Kontext von Kreativität gesehen werden. Auch hier geht es darum, “Grenzen (zu) überwinden” wie ein Buch von Mihály Csíkszentmihályi (2010) titelt.
7.3 Kreativität
Fotografieren kann, wie schon Bourdieu im Zusammenhang mit Selbstverwirklichung bemerkt (Bourdieu, 2006), den Wunsch, kreativ zu sein, befriedigen. Selbstverwirklichungsbedürfnisse werden oft mit Entfaltung und Befähigung in Verbindung gebracht (vgl. Mundt, 2009, S. 97) konkret mit “der Entfaltung eines inneren Kerns des Individuums auch gegen äußere Widerstände und […] einer im weitesten Sinne ästhetischen Transformation alltäglicher Wahrnehmung” (Reckwitz, 2012, S. 218). Ferner vermag kreatives Unterfangen zu “Stolz, Selbstwertgefühl und damit seelischer Gesundheit” führen (Schuster, 2016, S. 50) und auch das Erleben von Flow, begleitet “von einem Gefühl des Glücks und des Erfolgs” (ebd. 48) ermöglichen. Zahlreiche Workshops und (populär-)wissenschaftliche Bücher, die sich mit Kreativität beschäftigen, zeigen ferner, dass es als hochgradig erstrebenswert und sozial erwünscht gilt, kreativ zu sein. Kreativität steht in Verbindung mit dem “Neuen”, neue Ansichten kennenlernen, sich auf Neues einzulassen, damit in Verbindung zu einer persönlichen Entwicklung und Entfaltung. Mit Blick auf Kreativität weist das Fotografieren zwei interessante Besonderheiten auf: Zunächst erscheint es besonders leicht zugänglich, weil es aus der Alltagserfahrung bekannt ist, Fotokameras allgegenwärtig sind und der Vorgang auch ohne Vorwissen durchgeführt werden kann. Somit fällt es leicht, kreativ zu werden, ohne sich erst langwierigen Lernprozessen unterziehen zu müssen oder teure Materialien zu besorgen.
Außerdem bedeutet fotografische Kreativität etwas überspitzt formuliert, aufgrund der dem Medium innewohnenden Indexikalität, eine Auseinandersetzung mit den Unzulänglichkeiten der Realität. Sie sind es auch, die der Kreativität Grenzen geben – nicht alles, was im Kopf ist, kann zum Bildergebnis werden (vgl. Jerrentrup, 2018, S. 60; vgl. Reckwitz, 2012, S. 218). Kreativität ist damit nicht uferlos, sondern kann aufgrund der Auseinandersetzung mit der Realität eine Übung für problemlösendes Denken darstellen.
Mehr als ein Zehntel derer, die auf die Facebook-Frage geantwortet haben, nannte das Aus- oder Erleben von Kreativität als Motivation zum Fotografieren, unabhängig von den Bildergebnissen; in den Interviews war es ein bedeutend größerer Anteil, etwa zwei Drittel. Dabei muss bedacht werden, dass Kreativität meist auf ein Ziel, hier ein Bildergebnis ausgerichtet ist und daher schwieriger getrennt von den Bildresultaten betrachtet werden kann: Das kreative Produkt muss “‘gemacht’ werden […] Die Idee muss realisiert werden” (Krause, 1972, S. 42).
7.4 Impression Management und Embodiment
“Ein Foto sagt oft mehr über den Fotografen aus, als über das Fotografierte”, jedes Bild, das “eine Person macht oder auch aufhebt” und, so sollte man hinzufügen, präsentiert, “ist in gewisser Hinsicht auch ein Selbstportrait” (Weiser, o. J.) – solche häufig genannten Feststellungen zeigen, wie eng das Fotografieren mit der Identität verbunden ist. Bourdieu spricht von “Status” (Bourdieu, 2006), aber man kann auch allgemeiner formulieren, dass sich die Bildresultate hervorragend dazu eignen zu zeigen, wer man ist und wofür man steht – beziehungsweise welche Identität nach außen hin wahrgenommen werden soll: “Die PHOTOGRAPHIE hat …, historisch gesehen, als Kunst der Person begonnen: ihrer Identität, ihres zivilen Standes, dessen, was man, in jeder Bedeutung des Wortes, das An-und-für-Sich des Körpers nennen könnte” (sic, Barthes, 1989, S. 89). Gleich, welches Ziel die Fotos konkret verfolgen, ob es primär um das Geldverdienen geht, um möglichst viele Gefallensbekundungen in den Sozialen Medien, um die Anerkennung durch Verwandte und Freunde oder um die Vorstellung der Achtung durch die Nachwelt – man möchte man sich also stets in bestimmter Weise darstellen, Erving Goffman zufolge “Impression Management” (vgl. z.B. Maleyka, 2019, S. 3) betreiben, und antizipiert die Reaktionen der Zielgruppe beim Fotografieren selbst.
Besonders gut kontrollier- und steuerbar ist das eigene Image in den sozialen Medien, daher wähle ich dieses Beispiel. Fotos, selbst wenn sie nach kurzer Zeit in der Story oder Timeline verschwunden sind, helfen dabei, das öffentliche Bild zu formen. Für diese Fotos kann es sinnvoll sein, sich in Situationen zu begeben, die ungewohnt sind oder eigentlich nicht der eigenen Person entsprechen, wohl aber dem Eindruck, den sie von sich verbreiten möchte – beispielsweise, dass man als abenteuerlustig, kommunikativ, engagiert oder wohlhabend wahrgenommen wird.
Der Auslöser also mag eine gewisse oberflächliche Komponente beinhalten, man spricht mit Horkheimer und Adorno “von einer immer stärker um sich greifenden Selbstsucht und Entwurzelung in unserer Gesellschaft, was dazu führe, dass äußerer Schein mit anhaltender Kreativität und geistigem Engagement verwechselt werde, wie auch blinde Gefolgschaft gegenüber den Zwängen politischer und bürokratischer Organisationen mit individueller Moral sowie oberflächliche Kontakte mit genuiner Intimität” (Diamond, 2006, S. 172) und sieht hier das Bild des Narziss beschrieben. Allerdings kann bekanntlich auch eine zweifelhafte Motivation einen bedeutsamen Prozess auslösen, darunter nicht nur das Kennenlernen von Neuem, sondern auch das Präsentieren von Charaktereigenschaften, die man für erstrebenswert bzw. positiv konnotiert hält. Durch die Verkörperung beim Fotografieren ist eine Rückwirkung auf den Fotografierenden denkbar, wie es die Embodiment-Forschung nahelegt. Embodiment sei hier im Sinne der Psychologie kurz gesagt als folgender Zusammenhang verstanden: “States of the body, such as postures, arm movements, and facial expressions, arise during social interaction and play central roles in social information processing”, besonders interessiert dabei der vielfach belegter Fakt: “Bodily states in the self produce affective states” (Barsalou, Niedenthal, Barbey & Ruppert, 2003, S. 43). Komplexere und langzeitige Zusammenhänge zwischen Werten, Einstellungen, Verhalten und Embodiment mögen schwer zu belegen sein, zumindest aber bleibt festzuhalten, dass sich der Fotografierende durch seine Selbstpräsentation auch bewusst oder unbewusst mit für ihn als positiv erachteten Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen beschäftigt.
7.5 Selbstwahrnehmung
Wie sieht es aber mit den Fotos aus, die von Anfang an, schon bei ihrer Entstehung nicht oder nicht vornehmlich dem Ziel unterliegen, einer Öffentlichkeit präsentiert zu werden?
Auch hier spielt Identitätsarbeit eine Rolle. Heinz Abels nutzt in diesem Kontext die Metapher des Bildes, welche die Nähe zur Fotografie verdeutlicht: “Identität ist andauernde Arbeit an einem Bild, wer wir sein wollen” (Abels, 2017, S. 4), ein Bild, das wir anderen zeigen, aber auch selbst betrachten, um ein “Selbstverständnis als kohärentes Wesen mit bestimmten Eigenschaften und einer Geschichte” (Schönhuth, 2005, S. 91) zu erlangen. Auch wenn “Identität” oft mit der bewussten äußeren Aufmachung in Verbindung steht (Lauser, 2004, S. 469; Pavis, 2003, S. 174), ist auch die Art und Weise, wie wir fotografieren, selbst wenn wir dies nicht nach außen transportieren, Teil unserer Identität: Fotos, die nicht zur Präsentation gedacht sind, die nach dem Auslösen vielleicht nicht wieder betrachtet werden, bieten eine Möglichkeit, die Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung zu beeinflussen und damit die Wahrnehmung der eigenen Identität zu lenken – denn was ich sehe, worauf ich also Aufmerksamkeit lenke, was für mich bedeutsam ist, stellt einen wichtigen Teil dessen dar, was ich bin.
Zudem verleiht uns die Kamera alleine durch ihre Existenz als technisches Gerät, das uns zur Verfügung steht, schon den Titel einer Beschäftigung, somit schon eine (Teil-)Identität: Mit Kamera sind wir Fotografen. Dieser Berufstitel lässt sich umso leichter für sich nutzen, als dass das Fotografieren an sich verhältnismäßig einfach erscheint und kaum einer Vorbildung bedarf und weil die Berufsbezeichnung in Deutschland nicht (mehr) geschützt ist. Fotografieren kommt also im Paket mit einer neuen (Teil-)Identität, der eines Fotografen. Mag das auch im Fotografenhandwerk in der Praxis nicht immer der Fall sein, wird “Fotograf sein” doch mit Kreativität und Künstlertum assoziiert. So ermöglicht das Fotografieren eine neue, positive Selbstwahrnehmung.
Dieser Aspekt war in den Interviews etwas schwieriger anzusprechen und es bedurfte fast immer der Nachfrage, ob das Fotografieren die Selbstwahrnehmung beeinflusst. Auf meine Nachfrage hin wurde dies jedoch in den meisten Fällen bejaht: Die Interviewten sahen in den von ihnen gewählten Fotomotiven Ausdrücke ihrer Persönlichkeit und assoziierten den Begriff “Fotograf” mit positiven Eigenschaften: “Ich identifiziere mich gerne als Fotograf, das klingt gut”, drückte es einer von ihnen aus. In der Umfrage wurde dieser Aspekt nicht thematisiert.
8 An Activity in its own right
Fotografieren heißt nicht nur “Bilder machen” – auch abgesehen vom Produkt “Bild” ist Fotografieren eine Aktivität, die Aufmerksamkeit verdient. Zwar bleibt unklar, ob das Fotografieren seine Wirkungen in jeder Hinsicht erzielen würde, wenn keine Antizipation von Ergebnissen stattfinden würde – aber dass es sich um eine “activity in its own right” handelt, die für viele Menschen mit Freude und Selbstentfaltung verbunden wird, ist offensichtlich. Vor allem die Verbindung zu anderen Menschen, Aspekte im Zusammenhang mit Entspannung wie Ausgleich, Entschleunigung, Heilung und Meditation, sowie die Erweiterung des Horizonts spielen dabei eine wichtige Rolle.
Mit dem Fokus auf dem reinen Fotografieren ergeben sich besondere Einsatzmöglichkeiten. Die Therapie nutzt bereits das Potential des Fotografierens: Mit Blick auf die in der Fotografie notwendige Kreativität im Sinne eines Umgangs mit der Realität und ihren Unzulänglichkeiten lässt sich eine neue Perspektive auf den Alltag erleichtern. Außerdem kann der Blick mit Hilfe der Kamera geschärft werden und man lernt, mehr interessante Aspekte im Alltag wahrzunehmen. Auch die sozialen Medien und die Industrie stärken den Blick auf das Fotografieren: Facebook und Instagram ermöglichen seit kurzem, Erlebnisse in Stories zu zeigen. Dies wird von vielen Fotografen weniger als weitere Möglichkeit zur Präsentation fertiger Bilder genutzt, sondern dient mehr der Begleitung des Fotografierens selbst. Fotos, die nicht als Bildresultate gewürdigt werden sollen, sondern als Backstage-Fotos, zeigen die Planung von Shootings, sowie den Prozess des Fotografierens und die Bearbeitung der Bilder. Natürlich ist auch hier das ein oder andere Bild doch eher inszeniert, das heißt, ihm liegen umfassendere Überlegungen zur Selbstpräsentation zugrunde, und es sind in der Goffmanschen Terminologie so gesehen doch eher Front- als Backstage-Aufnahmen. Dennoch stehen der Prozess und das Erlebnis stärker im Vordergrund als bei den Bildresultaten.
Selfie-Spots und Museen wie das Kölner Supercandy Pop up gestalten Erlebnisse extra für die Fotografie. Die Leica M-D, eine 2016 vorgestellte Digitalkamera, die ohne Monitor auskommt und damit die Aufmerksamkeit ganz auf die Aktivität des Fotografierens fokussieren möchte, kann ebenfalls als eine Reaktion der Industrie gewertet werden. Das neuerlich gesteigerte Interesse an der Sofortbildfotografie betont die interaktive Komponente der Aktivität: Die gemeinsame Aktivität und das gespannte Erwarten des Ergebnisses scheinen hier oft wichtiger als das Resultat. Zahlreiche weitere Ideen, zum Beispiel pädagogische Einsatzmöglichkeiten des Fotografierens, sind denkbar und es bleibt spannend, welche Entwicklungen den Fokus auf die Aktivität folgen werden.
Interessenskonfliktstatement
Die Autor:innen erklären, dass ihre Forschung ohne kommerzielle oder finanzielle Beziehungen durchgeführt wurde, die als potentielle Interessenskonflikte ausgelegt werden können.
Referenzen
2 von Crossref erfasste Zitate
-
A Liberating Experience. On Becoming a Work of Art
Maja Tabea Jerrentrup et al. (2020)
Creativity. Theories – Research - Applications
DOI: 10.2478/ctra-2020-0020
-
Visuelle Autoethnografie
Evelyn Runge et al. (2022)
Rundbrief Fotografie
DOI: 10.1515/rbf-2022-3010
5 von Semantic Scholar erfasste Zitate
- Visuelle Autoethnografie
Evelyn Runge (2022)
Rundbrief Fotografie
DOI: 10.1515/rbf-2022-3010
- Body art
M. Jerrentrup (2021)
HAU: Journal of Ethnographic Theory
DOI: 10.1086/718319
- A Liberating Experience. On Becoming a Work of Art
M. Jerrentrup (2020)
DOI: 10.2478/ctra-2020-0020
- The Body As Canvas As Picture
M. Jerrentrup (2020)
International Journal of Cultural and Art Studies
DOI: 10.32734/IJCAS.V4I2.4062
- The Body as Canvas as Picture: Body painting and Its Implications for The Model
M. Jerrentrup (2020)
URL: View on Semantic Scholar
Erhalten
Akzeptiert
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenzinformation
Copyright (c) 2020 Maja Tabea Jerrentrup

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.