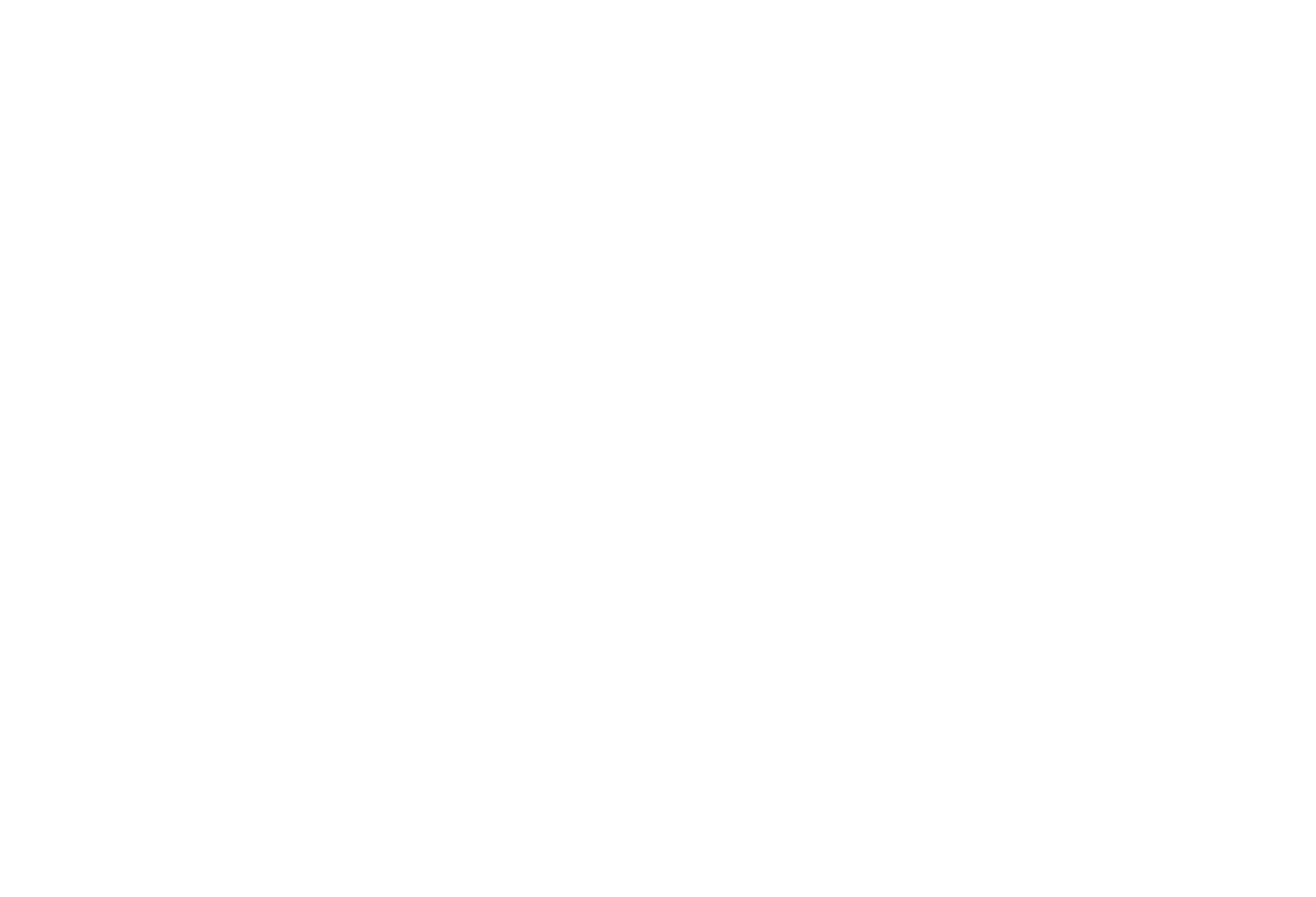What's your pace?
Gedanken zum Forschen mit und über digitale(r) Selbstvermessung
DOI:
https://doi.org/10.15460/kommges.2018.19.3.604Schlagworte:
Alltag, Digitalisierung, Körper, Optimierung, Fitness, Selbstverantwortung, Kulturanthropologie, Wissensproduktion, Feldforschung, neue Technologie, ForschungsprozessRedaktion und Begutachtung
Abstract
Welche Vorstellungen über Körper sind digitalen Selbstvermessungsinstrumenten eingeschrieben und wie wird dieses Wissen in den Alltagspraktiken von Nutzer_innen angewandt? Neben diesem Fokus auf das Forschen über den Umgang mit digitalen Fitness-Tracking-Apps und Devices soll dieser Beitrag auch das Forschen mit diesen thematisieren. Dies meint zum einen meine eigene Nutzung von digitalen Selbstvermessungs-Instrumenten sowie meine Erfahrung als „laufende“ Forscherin. In diesem Sinne thematisiert der Beitrag die verschiedenen Bedeutungsebenen von kulturanthropologischer Wissensproduktion über ein Feld, in dessen Mittelpunkt wiederum die Wissensproduktion über den eigenen Alltag zentral ist. Der Zugang kann zudem als „hacking“ im Sinne des Auslotens der Möglichkeiten ethnographischer Forschung verstanden werden. Dieser Zugang und seine Relevanz ergeben sich durch zwei einander überlappende Charakteristika des Forschungsfeldes. Zum einen lässt sich die Omnipräsenz und ein Heranrücken an den Körper von mobilen digitalen Geräten im Alltag nennen, zum anderen die zentrale Stellung des Körpers als zu Vermessendes für das Forschungsfeld. Anhand von Beispielen aus meiner Forschung zum Umgang mit digitalen Fitness-Tracking-Apps und -Devices, im Rahmen derer ein Selbstversuch, Interviews und Beobachtungen durchgeführt wurden (bzw. werden), zielt der Beitrag darauf ab, die beiden Ebenen des „Forschens über“ und des „Forschens mit“ zusammenzuführen. Somit wird die Verwobenheit von Feldforscherin, Forschungsprozess und Forschungsfeld expliziert.
1 Digitale Selbstvermessung – Skizze eines Forschungsfeldes
Digitale Selbstvermessung meint die Nutzung digitaler Instrumente zur Vermessung unterschiedlicher Bereiche des Alltags. Mit Smartwatches, Fitness-Armbändern und Apps vermessen Menschen ihre Bewegungen (Schrittanzahl, Workouts), aber auch die Dauer des Schlafs oder die Anzahl der zu sich genommenen und verbrauchten Kalorien. Entwicklungen wie diese werden von Nutzer_innen wie selbstverständlich in den Alltag integriert, sodass häufig in den Hintergrund tritt, dass die technischen Möglichkeiten nicht schon immer gegeben waren, sondern einer konkreten, fließenden Entwicklung unterliegen und daher nicht als selbstverständlich anzusehen sind (vgl. Rettberg 2018: 435). Eine zeitliche Einordnung im Kontext der Verbreitung mobiler digitaler Endgeräte von Apps und Devices, die eine solche Vermessung des Alltags ermöglichen, trägt zu einem besseren Verständnis des Phänomens bei.
Auf Selfies Bezug nehmend führt Jill Walker Rettberg aus, dass erst 2010 Smartphones mit hochwertigen Kameras und Bildschirmen sowie günstigen Daten-Tarifen verbreitet wurden. Rettbergs zusätzlicher Verweis, dass man bis 2008 nicht von Social Media, sondern von Web 2.0 gesprochen habe, verdeutlicht, wie jüngste Entwicklungen sich bereits als fester Alltagsbestandteil etabliert haben (vgl. ebd.). Als bedeutende Zeitmarke in Hinblick auf mobile digitale Endgeräte sei die Markteinführung des Apple iPhone im Jahr 2007 zu verstehen, die Gerard Goggin als Wendepunkt hin zur massenhaften Verbreitung von Smartphones beschreibt (vgl. 2012: 11). Gina Neff und Dawn Nafus betonen die Bedeutung technologischer Entwicklungen für die Datenspeicherung und -erfassung als eine Vorbedingung für die Vermessung von Alltagspraktiken: Bewegungserfassung wurde durch miniaturisierte Endgeräte, längere Akku-Laufzeiten und leistungsstarke Batterie-Chips ermöglicht, Bluetooth Smart sorgt für effiziente Konnektivität zwischen mehreren Endgeräten – wie Smartphone und Fitnessarmband – und Cloud Computing ermöglicht die Speicherung und Verarbeitung der mittels Sensoren erfassten Daten online (2016: 27). Durch die Verbreitung von Smartphones und anderen mobilen digitalen Endgeräten, die sich durch die technische Ausstattung (mit Bewegungssensoren etc.) für digitale Selbstvermessung eignen, ist diese Form des Wissenserwerbs über sich selbst besonders nah an die Individuen und ihre Körper herangerückt.
Diese Nähe kann zum einen als physische Nähe verstanden werden, die unter anderem im Tragen eines Armbands deutlich wird. Die Nähe lässt sich zum anderen auch als Resultat der selbstverständlichen Nutzung von Smartphones für unterschiedlichste mitunter private Zwecke (Kalender, Messaging) verstehen und daher als Nähe-Verhältnis, das durch die vermessenen Lebensbereiche etabliert wird: Die Vermessung von Schlaf, Herzschlag oder die Nutzung digitaler Menstruationskalender führen zu einer besonderen Qualität von Nähe zum Körper. Richtwerte wie pro Tag empfohlene Schrittzahlen oder die „ideale“ Schlafdauer scheinen über ein „gutes“ Leben Auskunft zu geben; gleichzeitig ermöglichen sie erst eine Unterscheidung von „der Norm entsprechendem“ und davon „abweichendem“ Verhalten. Die Vermessung lässt sich als Eingliederung von Körperdaten in Ordnungssysteme verstehen, die auf Wissensbestände eines „guten Lebens“ zurückgreifen. Darüber hinaus wird erst durch die Vermessung der Vergleich (eigener Aktivitäten und der mit anderen) ermöglicht. Gemessene Werte bilden die Grundvoraussetzung für Rankings, die vermeintlich Rückschlüsse auf die vermessenen Menschen zulassen. Durch die Vermessung der körperlichen Aktivitäten dehnt sich die neoliberale Anrufung in die intimsten Bereiche Einzelner aus.
Nicht nur deshalb sind Körper unter neoliberalen Gesichtspunkten eng mit der Subjektkonstruktion und mit Fragen nach einem „erfolgreichen“ Leben verknüpft. Bei einer genaueren Betrachtung des Leitmotivs Fitness, wie es Simon Graf beschreibt, offenbart sich die Wirkmächtigkeit des Körpers auf unterschiedlichste Lebensbereiche: Denn „Ein fitter Körper ist gefordert, um an Erfolg, Karriere, Gesundheit und Liebe partizipieren zu können“, so Graf (2013: 146). Nicht nur der berufliche Erfolg, sondern auch privates „Glück“ seien somit an die „Arbeit“ am eigenen Körper und somit an die Eigenverantwortung der Menschen gekoppelt. Die Arbeit ist folglich nicht mehr nur etwas, das mit dem Körper ausgeführt wird, sondern das am eigenen Körper zu leisten ist, um erfolgreich in anderen Bereichen arbeiten und konkurrieren zu können.
2 Quantifizierungslogiken: Machbarkeit und Eigenverantwortung
Körper, Wissen und digitale Technik stellen gegenwärtig einen Dreh- und Angelpunkt gesellschaftlicher Transformationen dar. Digitalität ermöglicht die Sammlung großer Mengen von Daten. Durch sogenannte Big Data werden nicht nur Tendenzen zu Überwachung und Vorhersehbarkeit gestärkt, sondern auch Ideen von (Selbst)Optimierung und Prävention. Als Big Data, von Shoshana Zuboff charakterisiert als “the foundational component in a deeply intentional and highly consequential new logic of accumulation“ (2015: 75), die sie als „surveillance capitalism” bezeichnet, sei eine neue Form des Informations-Kapitalismus zu betrachten, die darauf abziele, durch die Vorhersage und Modifikation von menschlichem Verhalten Gewinne und Marktkontrolle zu erzielen. (vgl. ebd). Dies verdeutlicht, wie Datensammlung in unterschiedlichsten Bereichen zur Vorstellung führt, Zukünftiges kontrollieren und beeinflussen zu können. Dem Beispiel digitale Selbstvermessung haftet unter anderem das Versprechen an, in der Zukunft liegende Gesundheitsrisiken durch Modifikation des – zuvor vermessenen Verhaltens – eliminieren zu können.
Lupton (2016) führt aus, dass bei digitaler Selbstvermessung zwischen freiwilliger Selbstüberwachung und von außen initiierter Selbstüberwachung (zum Beispiel für den Arbeitgeber, medizinische Untersuchungen) unterschieden werden muss. Digitale Selbstvermessung würde Nutzer_innen als „personally responsible for their own care and self-management” ebenso konstruieren, wie als Teil eines heterogenen Netzwerkes, das aus den angewandten technischen Geräten, aber auch aus Freund_innen und anderen Beteiligten bestehe (vgl. ebd.: 84).
Die im Umfeld von den beiden Journalisten Gary Wolf und Kevin Kelly 2007 gegründete Quantified Self-Bewegung gilt als „early adopter“ von digitaler Selbstvermessung und geht vom Leitspruch „Self-Knowledge Through Numbers“ aus.1 Menschen und ihre Lebensweise werden dabei grundsätzlich als verbesserungswürdig betrachtet und Technologien als Möglichkeit, diese Defizite auszugleichen. Der Möglichkeits-Charakter dieser Optimierungs-Instrumente erschließt sich aus der Eigenverantwortung der Individuen im Sinne gouvernementaler Logiken (vgl. Bröckling/Krasmann/Lemke 2000). Um Gesundheitsrisiken weitgehend zu eliminieren, sind Individuen gefordert, „richtige“ Entscheidungen in Bezug auf Sport und Ernährung zu treffen. Digitalen Fitness-Tracking-Apps und -Devices scheint das Versprechen eingeschrieben zu sein, dass sie es Individuen auf einfachste Art und Weise erlauben, normierte Vorstellungen von einem „richtigen“ oder „gesunden“ Leben umzusetzen. Die Grenze zwischen der Möglichkeit zur Partizipation und dem Zwang zur Eigenverantwortung ist dabei fließend. Smartwatches und Fitness-Apps motivieren dazu, sich mehr zu bewegen und weniger oder „das Richtige“ zu essen und bieten eine vermeintlich „einfache“ Lösung, um die Verantwortung für das eigene „gesunde“ Leben zu übernehmen.
Die mittels Smartphones, Smartwatches o.ä. erhobenen Daten werden nicht nur von Einzelpersonen genutzt, sondern kommen auch in der medizinischen Forschung verstärkt zum Einsatz. Dies fördert wiederum den Glauben an die gesundheitsfördernde Wirkung von digitaler Selbstvermessung. Zentral dafür ist die Bedeutung von Quantifizierung im Bereich medizinischer Forschung:
„Questioning the validity, objectivity, and usefulness of quantification in any area of human life, and above all in the area of medicine and health, is not easy. […] Modern medicine is based on accurate measurements of many different bodily processes and functions“ (Belliger/Krieger 2016: 26).
Beispielhaft lässt sich der im März 2015 von Apple präsentierte „ResearchKit“ nennen. Dabei handelt es sich um einen Open-Source Software-Baukasten, der die Programmierung von Apps ermöglicht, die mittels iPhone bzw. AppleWatch gesammelte Daten unter anderem für medizinische Langzeitstudien nutzbar machen.2
Neben der Veralltäglichung – Schrittzähler und andere Gesundheits- bzw. Fitness-Apps sind häufig auf Smartphones vorinstalliert und gehören zu deren Grundausstattung – lässt sich hier auch eine Ökonomisierung des Lebensstils beobachten. Diese Ökonomisierung betrifft nicht nur die Einbettung in Rankings und Vergleiche, sondern auch die Monetarisierung von vermessenen Alltagshandlungen (nicht nur auf der Ebene von Big Data). Versicherungen bieten zum Teil Zuschüsse beim Kauf von digitalen Fitness-Tracking-Devices (aber zum Beispiel keine Zuschüsse beim Kauf von Sportschuhen).3 Ein Schweizer Versicherungsunternehmen belohnt die Versicherten sogar mit CHF 0,40 wenn an einem Tag mehr als 10.000 Schritte erlaufen werden, CHF 0,20 werden ausbezahlt, wenn die Tages-Schrittzahl zwischen 7.500 und 9.999 liegt.4 Diese Zuschüsse und Förderungen stärken den Glauben an die gesundheitsfördernde Wirkung von digitalen Vermessungsgeräten und -Apps.
Beispiele wie die Monetarisierung von vermessenen zurückgelegten Schritten verdeutlichen nicht nur, wie unternehmerisches Denken auf alle Lebensbereiche übertragen wird (vgl. Bröckling 2007), sondern weisen vor allem auf die Bedeutung von Eigenverantwortung und Selbst-Kontrolle im Sinne gouvernementaler Funktionslogiken.
3 Ein spezifischer Blick auf Körper?
Mit digitaler Selbstvermessung geht die Projektion unterschiedlichster Formen von Bedrohungen auf den Körper einher. Die Eigenverantwortung von Einzelnen ist dabei im Spannungsfeld von Machbarkeit und Gefahrendiskurs zu verorten. Digitale Selbstvermessung zeichnet sich nicht zuletzt durch einen spezifischen pathologisierenden Blick auf Körper und den Lebensalltag aus: Pablo Abend und Mathias Fuchs charakterisieren „the self of the quantified self“ als „malleable and deficient, improvable only by technologically driven introspection“ (Abend/Fuchs 2016: 11). Gleichzeitig wird digitale Selbstvermessung aber auch als Ausweg aus dieser Risikobehaftetheit imaginiert. Boka En und Mercedes Pöll sehen digitale Selbstvermessung als Antwort der Quantified Self-Bewegung auf die Tatsache, dass menschliches Leben risikobehaftet sei: “It appears that something needs to be kept in check in order to control or pre-empt the fallout of being human, and the Quantified Self strategy to wrestling for this control is surveillance via self-tracking” (En/Pöll 2016: 43).
In Bezug auf „gute“ oder „richtige“ Lebensweisen existieren im Feld digitaler Selbstvermessung unzählige „Wahrheiten“, die den „richtigen Weg“ vorzugeben scheinen. Bei „gesundheitsorientierter Lebensführung“ handelt es sich jedoch um kein neues Phänomen (vgl. hierzu Wolff 2010: 196). Auch Selbstvermessung ist kein neuartiges Phänomen. Jill Walker Rettberg beschreibt Benjamin Franklins Selbstoptimierungs-Bestrebungen:
„Franklin chose 13 virtues he wanted to focus on and drew a chart with a column for each day of the week and a row for each virtue: temperance, silence, order, frugality, industry, sincerity, justice, moderation, cleanliness, chastity, tranquility and humility. He gave himself a black mark for each day he felt he hadn’t lived up to each virtue, and two marks if he had done particularly badly” (Rettberg 2014: 10).
Durch mobile digitale Endgeräte mit Sensoren und Apps, die digitale Selbstvermessung stützen und ermöglichen, wurde diese Form der Beschäftigung mit sich selbst technisch verfügbar. Gleichzeitig beeinflussen sich Wissen, und die Art und Weise, wie Körper wahrgenommen werden, gegenseitig. Als medizinhistorisches Beispiel lässt sich Barbara Dudens Analyse der medizinischen Gutachten von Dr. Johannes Pelargius Storch nennen, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 1.640 Patientinnen behandelte (vgl. Duden 2000). Duden kommt zum Schluss, dass die Krankenberichte von Storch die Aufmerksamkeit auf den mündlichen Ausdruck des gefühlten Körpers richteten (vgl. ebd.: 55). Bevor sich die moderne Medizin auf Pathologie fokussierte, stand der gelebte Körper im Zentrum der medizinischen Praxis und mit ihm die Wahrnehmungen und Gefühle der Patient_innen, so Duden (vgl. ebd.). Diese Entwicklung, die Wende von Humoralpathologie auf die Solidarpathologie5 zu Beginn des 20. Jahrhunderts, könne nicht nur als Wende in Bezug auf die medizinische Praxis gesehen werden, sondern auch als Wandel des Wissens über körperliche Zustände.
Barbara Duden spricht von der Entwicklung der Medizin auch als Prozess des Disembodiments, weil für Storchs Patientinnen und ihre Körpererfahrung, sowie die Erzählungen darüber, wie sie ihren Körper wahrgenommen haben, im Zentrum standen. Sie vergleicht die moderne Medizin und die Berichte von Dr. Storch aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und fasst zusammen: „today’s health care tends to replace feelings of the body’s imbalance by a diagnosis of organic dysfunctions to be managed by the physician“ (ebd.). Patient_innen als „Fälle“ bestehen aus visuellen Repräsentationen von Messungen und Abweichungen, Ultraschall- oder Röntgenbildern; aus genetischen Wahrscheinlichkeiten und Risiko-Evaluierungen werden Schlüsse abgeleitet. Cornelia Renggli verweist auf die Bedeutung von Technik bei Messungen als Teil ärztlicher Behandlungen. Messgeräte ermöglichen einerseits die Relevanzbestimmung und Vergleichbarkeit von einzelnen Werten, während sie andererseits „eine Distanz zu den Patient_innen schaffen“ (Renggli 2016: 19) Während hier die Autorität noch bei den behandelnden Ärzt_innen liegt, die die Befunde interpretieren und Schlüsse über den Zustand des Körpers von Patient_innen ziehen, erhalten Menschen, die digitale Selbstvermessung praktizieren, selbst Zugang zu Visualisierungen vermessener Körperbewegungen und -werte. Als Forschungsdesiderat lässt sich die Frage danach identifizieren, ob dieser Zugang zu Daten auch zu einem verfeinerten Körpergefühl führe – also genau jene Lücke wieder schließe, die Duden mit dem Begriff Disembodiment anspricht.
Aber welche Art von Wissen wird bei digitaler Selbstvermessung überhaupt verhandelt? Uwe Vormbusch weist auf die Vorstellung der Quantified Self-Bewegung hin, dass es „erstrebenswert sei, so viel wie möglich über sich zu wissen. Das Wissen über sich wird dabei als Voraussetzung von Selbstbestimmung und damit als ein Ziel im Rahmen einer normativen Ordnung qualifiziert, als eine Ressource, um die Fremdbestimmung durch professionelle Akteure (Ärzte beispielsweise) abzustreifen“ (Vormbusch 2016: 55). Die Soziologin Whitney Erin Boesel thematisiert die Frage, welche Daten relevant sind und welche nicht, in einem Bericht über die Quantified Self-Conference, die 2012 zum Thema „Mindfulness“ in Palo Alto stattfand. Boesel zufolge war diese Frage auf der Konferenz omnipräsent: „If data empowers individuals, what kinds of information do and do not count as data? What kinds of information have value, and to whom?“ (Boesel 2012: o.S.) Während 2011 im Zusammenhang mit Empowerment noch darüber diskutiert wurde, was mit den gesammelten Daten zu tun sei, wurde die Perspektive um diese Fragen erweitert: „What kinds of information are valuable? What kinds of data count?“ (ebd.). Boesel verweist auf eine Patientin einer Fruchtbarkeitsklinik, die herausfand, dass durch self-tracking ihr Körperwissen über den Zeitpunkt des Eisprungs gestärkt wurde. Boesel skizziert, wie die Ärzt_innen der Patientin aber nicht glaubten, dass ihr Eisprung gerade vonstatten gehen würde, weil ein Ovulations-Test das Gegenteil anzeigte. Obwohl durch Ultraschall festgestellt wurde, dass die Patientin recht hatte, „the clinicians continued to privilege (so-called) objective, quantified device-knowledge over her meticulously tracked but more qualitative self-knowledge“. Boesel argumentiert gegen Kevin Kellys Statement bei der Abschlusspräsentation, dass nur quantifizierbare Information mit anderen geteilt werden könne. Die Soziologin schreibt:
„The difficulty of sharing non-quantitative data has little to do with the data sets themselves, and has much more to do with our dominant epistemologies; it is not that some types of data can’t speak, but that some people in power refuse to listen“ (ebd.).
Objektive Messbarkeit ist nicht nur für die Medizin der Gegenwart zentral, sondern auch für die Quantified Self-Bewegung. Wahrheit sei in Zahlen, in quantifizierbaren Daten zu finden und nicht in den Gefühlen oder dem Wohlbefinden von Einzelnen. In Bezug auf individuelle Praktiken digitaler Selbstvermessung ist das Vor-Augen-Führen durch die Sammlung der Daten zentral. Zu sehen, wie weit und schnell man gelaufen ist, kann motivieren und Freude machen. Es kann aber auch dazu führen, dass sportliche Aktivität nicht mehr als solche zählt, wenn sie nicht vermessen und dokumentiert wurde. Eine 29jährige Nutzerin einer digitalen Pulsuhr führte im Interview aus:
„Wenn ich jetzt Sport mache, wenn ich jetzt wirklich laufen gehe oder wenn ich ins Fitness-Studio gehe, dann hab ich immer meinen Pulsgurt dabei. Und wenn ich fertig bin mit dem Sport mache ich meine App auf daheim am PC am Apple und dann überspiele ich die Daten auf die App. So habe ich vom Jahr 2016 eine genaue Graphik und weiß, wie oft ich Sport gemacht hab, wie viele Kalorien ich verbraucht habe, was mein Höchstpuls war in der Trainings-Einheit usw. Also ich (.) kann sagen, dass ich glaube ich von 140 Mal Sport, den ich heuer gemacht habe vielleicht zwei Mal (.) keine Apps verwendet habe. […] Nein man wird, man wird ein bisschen abhängig davon mental. Das ist nämlich das arge, weil (.) wenn du zum Beispiel jetzt keine […] App verwendest, dann ist das so als hättest du nie Sport gemacht. Weil das scheint nirgends auf. Und somit ist das quasi wieder (.) vergessen.“
Die Dokumentationsmöglichkeit via Pulsuhr wird hier unter anderem als Erinnerungsstütze (gegen das Vergessen) beschrieben, die es ermöglicht, die Werte im Jahresverlauf zu erfassen. Etwas später im Interview geht sie noch detaillierter darauf ein:
„Und mittlerweile könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich jetzt ohne (.) ohne Pulsuhr oder ohne den Gurt jetzt da irgendwie Laufen gehe oder so. Und wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern heimfahre, die haben auch ein Laufband, und ich vergesse […] diese Pulsuhr und den Pulsgurt daheim, dann mache ich gleich gar keinen Sport. […] Weil dann denke ich mir ‚Nein, das kannst du nicht aufzeichnen.‘ […] Und wenn ich es nicht aufzeichnen kann dann macht es mir auch keine Freude, das ist total schräg. […] Jaja, das ist total extrem, ja. […] Also ich häng mich da scheinbar wirklich sehr auf das auf. (.) Auf dieses (.) Kontrollieren, und dieses – ja, sehen was du gemacht hast am Ende von der Trainings-Einheit, gell.“
Digitale Selbstvermessung erfüllt hier eine Beweis-Funktion, die sportlichen Aktivitäten mehr Wert verleiht und gleichzeitig den vermessenen und nicht-vermessenen Aktivitäten unterschiedliche Realitätsgrade zuweist.
Digitale Selbstvermessungs-Instrumente vereinfachen nicht nur die Sammlung von Daten zu Bewegung, zum Schlaf oder zur Ernährung der Nutzer_innen, sie verknüpfen diese auch mit anderen Parametern und bringen sie in eine visuelle und zeitliche Ordnung. Schrittzahlen und andere gesammelte Daten werden visualisiert, kontextualisiert und in Relation zu anderen Daten gesetzt. Sie werden sozusagen übersetzt, um die erbrachte Leistung auf einen Blick zugänglich zu machen. Ina Dietzsch (2015) spricht im Zusammenhang solcher Visualisierungen vom „Erzählen mit Zahlen“ und argumentiert mit Verweis auf Sibylle Krämer, dass diese auch eine räumlich-leibliche Ordnung transportieren würden: „Diagramme organisieren Daten in einer meist nicht-linearen, schematisch-abstrakten Ordnung. Ihre ordnende Matrix besteht jedoch nicht im Nacheinander, sondern im Nebeneinander und Untereinander und gewährt Überblick und Übersicht zugleich“ (Krämer 2013: 166; zit. n. Dietzsch 2015: 36). Durch einen „phänomenalen Leibbezug“ ergebe sich dabei die Sinnhaftigkeit der Anordnungen:
„Die dargestellten Relationen haben eine Richtung, die auf die Leiblichkeit der Betrachtenden bezogen ist. Oben und unten wird dabei als hierarchische Ordnung (Kopf und Fuß), rechts und links im Zusammenhang mit habitualisierten Schreibrichtungen verstanden“ (ebd.: 36).
Deborah Lupton folgert, dass sich im Entstehungsprozess von Daten-Repräsentationen und Visualisierungen die Daten verfestigen würden („are made ‚solid‘“) und deren Flüssigkeit an manchen Punkten einfrieren würde (Lupton 2016: 45). Dadurch, so möchte ich argumentieren, werden Körperordnungen im doppelten Sinn reproduziert: Zum einen durch den Leib-Raum-Bezug und zum anderen durch die Annahmen über Körper, die den visualisierten Daten eingeschrieben sind. Diese Annahmen sind kulturell geprägt und beeinflussen, welche Werte wozu gemessen werden sollen und welche Richtwerte dabei als „empfehlenswert“ gelten. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf bestimmte, als vermessenswert angesehene Bereiche. Visualisierungen von Körper- bzw. Aktivitätswerten nehmen daher nicht nur auf die leibliche Ebene Bezug, sondern auch auf kulturelle Annahmen vom Umgang mit Körpern und dadurch auch auf die Frage, welches Verhalten für wen als gesund, pathologisch, angemessen oder nötig eingestuft wird. Daraus lässt sich folgern, dass Differenzen (z.B. sozial, genderspezifisch) mittels Diagrammen von Tracking-Apps scheinbar objektiv begründet durch Quantifizierung und den wissenschaftlich anmutenden Charakter dieses Darstellungsformates reproduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass sich ihre Wirkmacht jedoch erst durch das „Erzählen mit Zahlen“, das die abstrakten Werte der Quantifizierung direkt mit dem Alltag der Individuen verknüpft, entfaltet. In bestimmten Kontexten als Profiling angewandt, reproduziert diese Form der Datensammlung Machtverhältnisse.
„Biometric data have become increasingly used in forms of inclusion and exclusion and in the maintenance of borders and other boundaries. In the discourse of biometric surveillance technologies, the body becomes represented as a site of information, made up of data flows and circulations” (Lupton 2016: 54).
Körper über Daten erfassbar zu machen, geht also mit einer spezifischen Betrachtungsweise einher, die sowohl zu Inklusion als auch zu Exklusion beitrage und damit in höchstem Maß politisch ist.
4 „What’s your pace?“
Die Vermessung des Alltags ermöglicht nicht nur die Dokumentation, sondern auch den Vergleich: Nutzer_innen können sich mit sich selbst vergleichen (bin ich im Laufe der letzten Wochen schneller geworden oder weiter gelaufen?), wie auch mit anderen. Stefan Groth bezeichnet den Vergleich mit anderen als Grundlage von Transparenztechniken. Der Leistungsvergleich führe zu einer Ausdehnung des Digitalen, die sich auf das Konkurrenzdenken und die eigene Erfahrung bei der Aktivität auswirke (vgl. Groth 2014: 49). Um die Wirkung solcher den Vergleich ermöglichenden Richtwerte in konkreten Situationen zu zeigen, gehe ich nun näher auf eine Situation aus meinem Forschungsalltag ein. Um eigene Erfahrungen mit digitaler Selbstvermessung zu sammeln, habe ich unter anderem ein Fitness-Armband und eine Laufapp genutzt, aber auch Beobachtungen beim Laufen mit anderen Menschen festgehalten.
Es war ein frostig-kühler sonniger Samstagmorgen im März 2017, als ich das Haus verließ, um am Lauftraining einer Fitness-Gruppe teilzunehmen. Ich hatte im Vorfeld mit dem Gruppen-Organisator geschrieben und ihn um ein Interview gebeten. Tom hatte vorgeschlagen, ich solle doch einfach vorbeikommen und mitlaufen und ihn befragen, während wir laufen. Mit dieser für Feldforschende wenig verlockenden Aussicht ging ich frühmorgens zum Treffpunkt, im Hinterkopf der Gedanke, dass er nicht mit mir sprechen würde, wenn ich dort nicht auftauche. Eine Freundin, mit der ich selbst regelmäßig laufen gehe, hatte angeboten mich zu begleiten, was ich dankbar annahm. Als wir am Treffpunkt, einem repräsentativen Ort im Zentrum der Stadt, ankamen, warteten bereits zwei andere Teilnehmerinnen im Alter zwischen Mitte zwanzig und Mitte 30. Kurz danach tauchte der Organisator in einem Sport-Outfit in den zum Forschungszeitpunkt verbreiteten Schwarz- und Grautönen auf, wie sie auch die Protagonist_innen in Fitness-App-Werbe-Videos zu dieser Zeit häufig trugen.6
Nachdem wir uns mit Dehnungsübungen aufgewärmt hatten, ging es daran, loszulaufen. Doch bevor wir das machten, erkundigte sich Tom bei allen Teilnehmenden: „Und, was ist deine Pace?“. Bei der Pace handelt es sich um die Zeit, die gebraucht wird, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Erst seit meinem Selbstversuch mit einem Fitness-Armband weiß ich, wofür die Pace steht und das, obwohl ich bereits seit ungefähr acht Jahren laufe. An diesem Samstagmorgen im März war ich mir nicht sicher, welche Zahl hier am ehesten meiner Laufgeschwindigkeit entspräche, da ich persönlich bis dato nicht so stark darauf geachtet hatte. Schließlich sagte ich, dass ich ungefähr so schnell laufen würde, wie meine Begleiterin. Es war das erste Mal in meinem Läuferinnen-Leben, dass mich jemand nach meiner Pace gefragt hatte. Gleichzeitig wurde die Frage mit einer Selbstverständlichkeit gestellt, die suggeriert, dass es für die Lauf-Aktivität nötig und vor allem gewöhnlich sei, die eigene Pace zu kennen. Ein Grund für diese angenommene Gewöhnlichkeit ist die Verfügbarkeit von digitalen Messinstrumenten am Smartphone, das sich im Alltag meist in unmittelbarer Nähe der Nutzer_innen dieses mobilen digitalen Endgeräts befindet.
5 Verschränkte Felder: Forschen über und mit dem Körper
In Bezug auf Feldforschungen und die daran beteiligten Subjekte tragen mobile digitale Endgeräte zu einer besonderen Nähe zwischen Forscher_innen-Ich und Privatem Ich (vgl. Massmünster 2014), zwischen Forschung und Nicht-Forschung sowie Forschenden und anderen an der Forschung beteiligen Personen (z.B. Interview-Partner_innen) bei. Aus diesem Grund fokussiert dieser Beitrag nicht nur aus Sicht der Menschen, die ihren Alltag digital selbst vermessen auf die Schnittstelle zwischen Körper, Wissen und digitalen Geräten. Vielmehr wird aus einer weiteren Perspektive meine Rolle als Forscherin, die sich mit digitaler Selbstvermessung befasst und unter anderem ihr Smartphone und ein Fitness-Armband im Forschungsprozess einsetzt, beleuchtet. In diesem Sinne lässt sich von einem Forschen, „in“, „mit“ Digitalem und „über“ Digitales sprechen.
Die Bedeutung von Internetforschenden „im eigenen Feld“ wurde bereits 2001 von Klaus Schönberger thematisiert. Anhand des Falls Claudio Belmonte – Schönberger gab seinem Forscher-Ich die italienische Übersetzung seines Namens – wird veranschaulicht, wie dessen Nutzungspraxen „für irrelevant erklärt und damit wesentlich Erkenntnisschritte behindert“ wurden, da Belmonte als für das Projekt nicht interessanter „Sonderfall“ wahrgenommen wurde (Schönberger 2001: 184-186). Mit Verweis auf Claudio Belmonte entfaltet sich die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen forschendem Ich und privatem Ich zu reflektieren, insbesondere, wenn dies – wie in meinem Fall – nicht als Alter Ego in den Text geschrieben wird. Reflexion kann hier als Distanzierungsinstrument betrachtet werden, das für einen analytischen Umgang mit dem Verhältnis von Forscher_innen-Ich und privatem Ich sorgt. Sarah Pink (2007) verweist auf die zentrale Stellung der Subjektivität von Feldforschenden und die sich daraus ergebende Notwendigkeit zur Reflexion der eigenen Position im Forschungsprozess; sie begreift
„Ethnography as a process of creating and representing knowledge (about society, culture and individuals) that is based on ethnographers own experiences. It does not claim to produce an objective or truthful account of reality, but should aim to offer versions of ethnographers’ own experiences that are as loyal as possible to the context, negotiations and intersubjectivities through which the knowledge was produced. […] A reflexive approach recognizes the centrality of the subjectivity of the researcher to the production and representation of ethnographic knowledge“ (ebd.: 22-23).
Seit Schönbergers Forschung hat sich die Bedeutung digitaler Technik im Alltag nicht nur durch den selbstverständlichen Einbezug in immer mehr Alltagsbereiche verstärkt, sondern auch gewandelt. Beispielhaft lässt sich der Einbezug von Smartphones in den Forschungsalltag nennen. Sie dienen als Dokumentations-Instrumente (Screenshots, Notiz-Apps, Kamera), als Ersatz für Diktiergeräte oder ermöglichen nicht nur die Recherche zu Forschungsthemen, sondern auch die Kommunikation mit Interview-Partner_innen.
Sarah Pink und Michel Massmünster folgend begreife ich mein Forscherinnen-Ich und meine Wahrnehmung als zentralen Teil des Forschungsfeldes und somit auch meinen Körper (vgl. Vetter/Mohr 2014: 102). Um die durch meine Interaktion erhobenen und wahrgenommenen Erfahrungen für die Forschung in „Daten“ zu verwandeln, begegne ich dieser Perspektive mit Reflexion. Diese wird durch ein während der Forschung geführtes Forschungstagebuch (vgl. Eisch-Angus 2017), sowie die regelmäßige Teilnahme an einer „ethnopsychoanalytischen Deutungswerkstatt“ in Graz unterstützt, bei der Forschungsmaterialien von der Gruppe diskutiert werden (Vgl. Bonz/Eisch-Angus/Hamm/Sülzle 2017). Beide sind als Instrumente zu verstehen, die dazu beitragen, Verzerrungen im subjektorientierten Forschungszugang sichtbar zu machen. In der Supervisionsgruppe werden Tagebuch-Einträge, Interview-Transkriptionen u.ä. auf Irritationen und Auffälligkeiten hin besprochen. Dies hilft, blinde Flecken der Forschenden und Dynamiken zwischen den im Material präsenten Personen freizulegen.
Der Forschungsprozess ist unter anderem durch meine eigene biographische Verwobenheit mit dem Laufen verknüpft. Meine Erfahrungen mit einem Sport, den auch viele Interview-Partner_innen betreiben, beeinflusst die Interview-Situation. Im Sinne eines Wissens-Austauschs, der zudem eine zentrale Praxis digitaler Selbstvermessung ist, wird dadurch eine stärker partizipative Ausrichtung der Interview-Situation hergestellt. Wenn die Menschen mich während der Interviews nach meinen Erfahrungen mit Apps bzw. meiner eigenen sportlichen Aktivität fragen, beeinflusst dies die Interview-Situation. Situationen des neugierigen Austauschs, der gegenseitigen Anerkennung (bei gleichzeitigem Wissen, wovon die Rede ist), aber auch mögliche Konkurrenz werden zugelassen.
Körper, Wissen und digitale Technik sind nicht nur im Feld digitaler Selbstvermessung eng miteinander verwoben, sondern auch in der Feldforschungspraxis. Beiden Perspektiven geht es um Wissensproduktion. Digitale Selbstvermessung ermöglicht die Sammlung und (meist) visuelle Aufbereitung von Bewegungsdaten und den Vergleich dieser Praktiken. Ethnograph_innen bereiten Wissen über Menschen und ihr Alltagsleben auf, das meist in schriftlicher Form. Die Parameter, anhand derer dieses Wissen erhoben wird, sind jedoch grundverschieden: Während Fitness-Apps und Devices meist mit quantifizierbaren Parametern arbeiten, kann die Interaktion mit Menschen und das Verstehen dieser als Kernmoment ethnographischer Forschung genannt werden. Ein Verharren auf einer vermeintlichen Polarität von quantitativen und qualitativen Daten wäre hier aber ebenso kurzsichtig wie unproduktiv wie ein Ausblenden des „Eigenanteils“ (Wolff 2010: 171) der Nutzer_innen, also deren Handlungsmöglichkeiten abseits der technischen Vorgaben, von Fitness-Apps und -Devices für deren Bedeutung.
Das Forschungsfeld digitaler Selbstvermessung kann somit als Nahtstelle angesehen werden, die einen reflektierten subjektiven Forschungszugang auf besondere Weise einfordert: Einerseits durch die zentrale Stellung des Körpers im Forschungsfeld, andererseits durch eine fließende allgegenwärtige Präsenz digitaler Endgeräte im Alltag (die nahe an eben jenen Körper herangerückt sind). Brigitta Schmidt-Lauber (2007) verweist auf Gisela Welz, die nicht stationäre Feldforschung als „stetes Pendeln in das und aus dem Feld“ beschreibt. Denn
„[a]nders als die Feldforschungsmethode der Ethnologie (Völkerkunde), die ursprünglich die dauerhafte, stationäre Feldforschung im fremden Terrain vorsah, führte die Volkskunde/Europäische Ethnologie jedenfalls zumeist Feldforschungen im gesellschaftlichen Nahbereich und zunehmend auch in unüberschaubaren Feldern wie urbanen Settings durch.“ (vgl. Welz 2005: 25 f.; zit. n. Schmidt-Lauber 2007: 228).
Dieses Oszillieren in das Feld hinein und aus dem Feld heraus wird durch die stetige Präsenz mobiler digitaler Endgeräte im Alltag von Forschenden verstärkt. Diese Geräte können potenziell Türöffner zum Feld und den Akteur_innen des Feldes sein, sowie zur diskursiven Ebene, etwa, wenn Informationen und (Re)Präsentationen des Forschungs-Themas in unterschiedlichen Social Media-Kanälen zu beobachten sind. Die von Rolf Lindner betonte Bedeutung von Reziprozität (Lindner 1981: 62) bezieht sich folglich, so möchte ich argumentieren, nicht nur auf die Akteur_innen, die sich im Zuge des Forschungsprozesses begegnen, sondern auch auf Forschende und ihren Umgang mit Smartphones, Online-Diensten und anderem. „Gehen wir davon aus, dass die Forschungssituation aktuell oder potentiell reziprok ist, dann kann daraus nur der eine Schluss gezogen werden, dass diese Reziprozität, da sie nicht einseitig aufkündbar ist, bewusst gemacht werden muss“ (ebd). Soziale Beziehungen sind daher „im Forschungsprozess zu reflektieren“ (ebd.), genauso wie der Einfluss der benutzten Gadgets und technischer Instrumente.
Der Forschungsalltag von Forschenden und Interview-Partner_innen und die Interaktion mit digitaler Technik lassen sich also als reziproke Wissenspraktiken verstehen, die auf Wissensbestände und Erfahrungen Einfluss nehmen. Im Sinne der „ethnographischen Brille“ fokussieren Forschende auf ein bestimmtes Thema und verändern damit gleichzeitig ihren Blick auf den sie umgebenden Alltag.
6 Schluss
Der Fokus, der in digitale Selbstvermessungsinstrumente eingeschrieben ist, ist es auch der die Verbindung zu unterschiedlichen Fragen des Politischen herstellt. Zum einen sind es Körper, die vermessen werden und aufgrund der vermessenen Daten in ein Vergleichssystem eingeordnet werden. Darüber hinaus ist digitale Selbstvermessung als ein Teilbereich der Datensammlung zu sehen; der Bereich des „Profiling“ weist hier auf das exkludierende bzw. inkludierende Potential von Datenprofilen hin (vgl. Lupton 2016: 54).
Die Fokussierung auf ganz bestimmte Richtwerte wie pro Tag empfohlene Schrittzahlen oder die „ideale“ Schlafdauer zielt auf eine Unterscheidung von „der Norm entsprechendem“ und davon „abweichendem“ Verhalten ab und eröffnet damit eine politisch relevante Dimension des Feldes digitaler Selbstvermessung, dessen Ambivalenz darin besteht, dass es Individuen vermeintlich Zugang zu ihren personen- und gesundheitsbezogenen Daten ermöglicht. Vermeintlich, weil die Formen der Darstellung und Speicherung dieser Daten häufig begrenzt sind. Technische Gebrechen wie Software-Fehler können dazu führen, dass die in der Cloud gespeicherten Daten nicht mehr korrekt angezeigt werden. Darüber hinaus muss mitunter eine Bezahlversion der jeweiligen App gekauft werden, um auf alle bisher getrackten Aktivitäten zugreifen zu können (und nicht nur die kürzlich erfolgten). Es gilt also nicht nur in den eigenen Körper zu investieren – „sportliche“ Menschen konnten während der Feldforschung als ein beliebtes Werbesujet von Geldinstituten beobachtet werden – sondern auch in die Verbesserung des bereits vorhandenen Equipments.
Durch die technische Verfügbarkeit von Alltagsvermessung ermöglichenden Smartphones und die gesundheitsfördernde Konnotation dieser Art der Alltagsdokumentation fällt es schwer, sich der Vermessung des Alltags bewusst und vollständig zu entziehen. Wer bereits einen Schrittzähler oder andere Selbstvermessungs-Instrumente bei sich trägt hat in dieser Hinsicht „No excuses“.
Literatur
Abend, Pablo und Mathias Fuchs, 2016, Introduction, S. 5-21, in: Pablo Abend und Mathias Fuchs (Hg.): Quantified Selves and Statistical Bodies. Digital Culture & Society 2/1. Bielefeld. transcript.
Belliger, Andréa und David J. Krieger, 2016, From Quantified to Qualified Self. A Fictional Dialogue at the Mall, S. 25-40, in: Pablo Abend und Mathias Fuchs (Hg.): Quantified Selves and Statistical Bodies. Digital Culture & Society. 2/1. Bielefeld. transcript.
Boesel, Whitney Erin, 2012, The Woman vs. The Stick: Mindfulness at Quantified Self 2012. Online-Publikation: https://thesocietypages.org/cyborgology/2012/09/20/the-woman-vs-the-stick-mindfulness-at-quantified-self-2012. (Stand: 17.07.2018).
Bonz, Jochen, Katharina Eisch-Angus, Marion Hamm, und Almut Sülzle (Hg.), 2017, Ethnografie und Deutung. Gruppensupervision als methode reflexiven Forschens. Wiesbaden. Springer Fachmedien.
Bröckling, Ulrich, 2007, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt/Main. Suhrkamp.
Bröckling, Ulrich, Susanne Krasmann und Thomas Lemke, 2000, Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt/Main. Suhrkamp.
Craik, Jennifer, 2018, Athleisure: On the materiality and transgression of sports uniforms, in Heike Jenss und Viola Hofmann (Hg.): Fashion and Materiality: Cultural Practices, Global Contexts. London /New York. Bloomsbury Academic. (In Druck). Preprint verfügbar unter
https://eprints.qut.edu.au/112269. (Stand: 16.07.2018).
Dietzsch, Ina, 2015, Erzählen mit Zahlen, Zeitschrift für Volkskunde. Beiträge zur Kulturforschung, 2015 (1), 111. Jahrgang: 31-53.
Duden, Barbara, 2000, Disembodied Health, New Perspectives Quarterly, Winter 2000: 54-59.
Eisch-Angus, Katharina, 2017, Wozu Feldnotizen? Die Forschungsniederschrift im ethnographischen Prozess, kuckuck. Notizen zur Alltagskultur „Forschen“ 02/17: 6-10.
En, Boka und Mercedes Pöll, 2016, Are you (self-)tracking? Risks, norms and optimisation in self-quantifying practices, Graduate Journal of Social Science April 2016, Vol. 12, Issue 2: 37–57 Online-Publikation: http://gjss.org/sites/default/files/issues/chapters/papers/GJSS%20Vol%2012-2%202%20En%20and%20Po%CC%88ll\_0.pdf. (Stand: 16.07.2018).
Goggin, Gerard, 2012, The iPhone and Communication, S. 11-27, in: Larissa Hjorth, Jean Burgess und Ingrid Richardson (Hg.): Studying Mobile Media. Cultural Technologies, Mobile Communication and the iPhone, Routledge Research in Cultural and Media Studies. New York/Abingdon, Routledge.
Graf, Simon, 2013, Leistungsfähig, attraktiv, erfolgreich, jung und gesund: Der fitte Körper in postfordistischen Verhältnissen, Body Politics 1, Heft 1 2013: 139-157.
Groth, Stefan, 2014, Quantified Cyclists and Stratified Motives: Explorations into Age-Group Road Cycling as Cultural Performance, Ethnologia Europaea 44 (1): 38–56.
Krämer, Sybille, 2013, Glossar. Grundbegriffe des Bildes. Diagrammatisch, Rheinsprung 11 – Zeitschrift für Bildkritik (Eikones): 162-175.
Lindner, Rolf, 1981, Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung als Interaktionsprozeß, Zeitschrift für Volkskunde 77, 1: 51-66.
Lupton, Deborah, 2016, The Quantified Self. A Sociology of Self-Tracking. Cambridge/Malden. Polity Press.
Massmünster, Michel, 2014, Sich selbst in den Text schreiben, S. 522-538, in: Christine Bischoff, Karoline Oehme-Jüngling und Walter Leimgruber (Hg.): Methoden der Kulturanthropologie. Bern. Haupt.
Mohr, Sebastian und Andrea Vetter, 2014, Körpererfahrung in der Feldforschung, S. 101-116, in: Christine Bischoff, Karoline Oehme-Jüngling und Walter Leimgruber (Hg.): Methoden der Kulturanthropologie. Bern. Haupt.
Neff, Gina und Dawn Nafus, 2016, Self-Tracking. Cambridge. MIT Press.
Pink, Sarah, 2007, Doing Visual Ethnography. London. Sage Publications.
Renggli, Cornelia, 2016, Auf dem Untersuchungstisch. Zur Verkörperung von Pathologien, kuckuck. Notizen zur Alltagskultur „Pathologien“ 01/16: 18-20.
Rettberg, Jill Walker, 2018, Self-Representation in Social Media, S. 429-443, in: Jean Burgess, Alice Marwick und Thomas Poell (Hg.): SAGE Handbook in Social Media. London. Sage.
Rettberg, Jill Walker, 2014, Seeing Ourselves Through Technology. How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves. London. Palgrave.
Schmidt-Lauber, Brigitta, 2007, Feldforschung. Kulturanalyse durch teilnehmende Beobachtung, S. 219-248, in: Silke Göttsch und Albrecht Lehmann (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. Berlin. Dietrich Reimer Verlag.
Schönberger, Klaus, 2001, Der Internetforscher im eigenen Feld. Oder die Unmöglichkeit ohne die Ausnahme die Regel zu denken, S. 184-197, in: Katharina Eisch-Angus und Marion Hamm (Hg.): Die Poesie des Feldes. Beiträge zur ethnographischen Kulturanalyse. Tübingen. Tübinger Vereinigung für Volkskunde.
Vormbusch, Uwe, 2016, Taxonomien des Selbst. Zur Hervorbringung subjektbezogener Bewertungsordnungen im Kontext ökonomischer und kultureller Unsicherheit, S.45-62, in: Stefanie Duttweiler, Robert Gugutzer, Jan-Hendrik Passoth und Jörg Strübing (Hg.): Leben nach Zahlen, Bielefeld. transcript.
Wolff, Eberhard, 2010, Moderne Diätetik als präventive Selbsttechnologie: Zum Verhältnis heteronomer und autonomer Selbstdisziplinierung zwischen Lebensreformbewegung und heutigem Gesundheitsboom, S. 169–201, in: Martin Lengwiler und Jeannette Madarasz (Hg.): Das präventive Selbst. Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheitspolitik. Bielefeld. transcript.
Zuboff, Shoshana, 2015, Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization, Journal of Information Technology 30: 75-89.
Datenverfügbarkeit
Alle relevanten Daten befinden sich innerhalb der Veröffentlichung.
Interessenskonfliktstatement
Die Autor:innen erklären, dass ihre Forschung ohne kommerzielle oder finanzielle Beziehungen durchgeführt wurde, die als potentielle Interessenskonflikte ausgelegt werden können.
So das Motto einer Plattform der Bewegung; vgl. http://quantifiedself.com (Stand: 21.09.2018).↩︎
Vgl. ResearchKit und CareKit – Apple (AT): http://www.apple.com/at/researchkit (Stand: 16.07.2018).↩︎
Die Versicherung „AOK“ bietet Zuschüsse zu „Quantified Self-Hardware“: http://www.aok.de/nordost/leistungen-service/aok-gesundheitskonto-248715.php (Stand: 16.07.2018).↩︎
Vgl. den Leitfaden der CSS Versicherung zum Programm „MyStep“: https://mystep.css.ch/files/myStep-Leitfaden-Anmeldung.pdf (Stand: 16.07.2018). Für diesen Hinweis danke ich Cornelia Renggli.↩︎
Während die Humoralpathologie Krankheiten an Veränderungen der Körpersäfte festmacht, lokalisiert die Solidarpathologie Krankheiten in Veränderungen der festen Körperteile.↩︎
Die Schwarz- und Grautöne dominieren auch die sogenannte „Athleisure“ –Sportkleidung, die in Alltagskontexten getragen wird. Jennifer Craik (in Druck) beschreibt dies wie folgt: „‘athleisure’ – a type of clothing that is not just functional for sport, but also conveys the appearance of ‘sportiness’ and ‘fitness’“ und argumentiert, dass das Tragen von spezifischer Sportkleidung in anderen Kontexten das Verhältnis von Körpern und Kleidung ändern würde.↩︎
2 von Crossref erfasste Zitate
-
Handbuch Soziale Medien
Ulrike Wagner et al. (2021)
Book content
DOI: 10.1007/978-3-658-03895-3_15-2
-
Handbuch Soziale Medien
Ulrike Wagner et al. (2022)
Book content
DOI: 10.1007/978-3-658-25995-2_15
1 von Semantic Scholar erfasste Zitate
- Kompetenzen für soziale Medien
U. Wagner (2021)
Springer Reference Sozialwissenschaften
DOI: 10.1007/978-3-658-03765-9_15
Erhalten
Akzeptiert
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenzinformation
Copyright (c) 2020 Barbara Frischling

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.