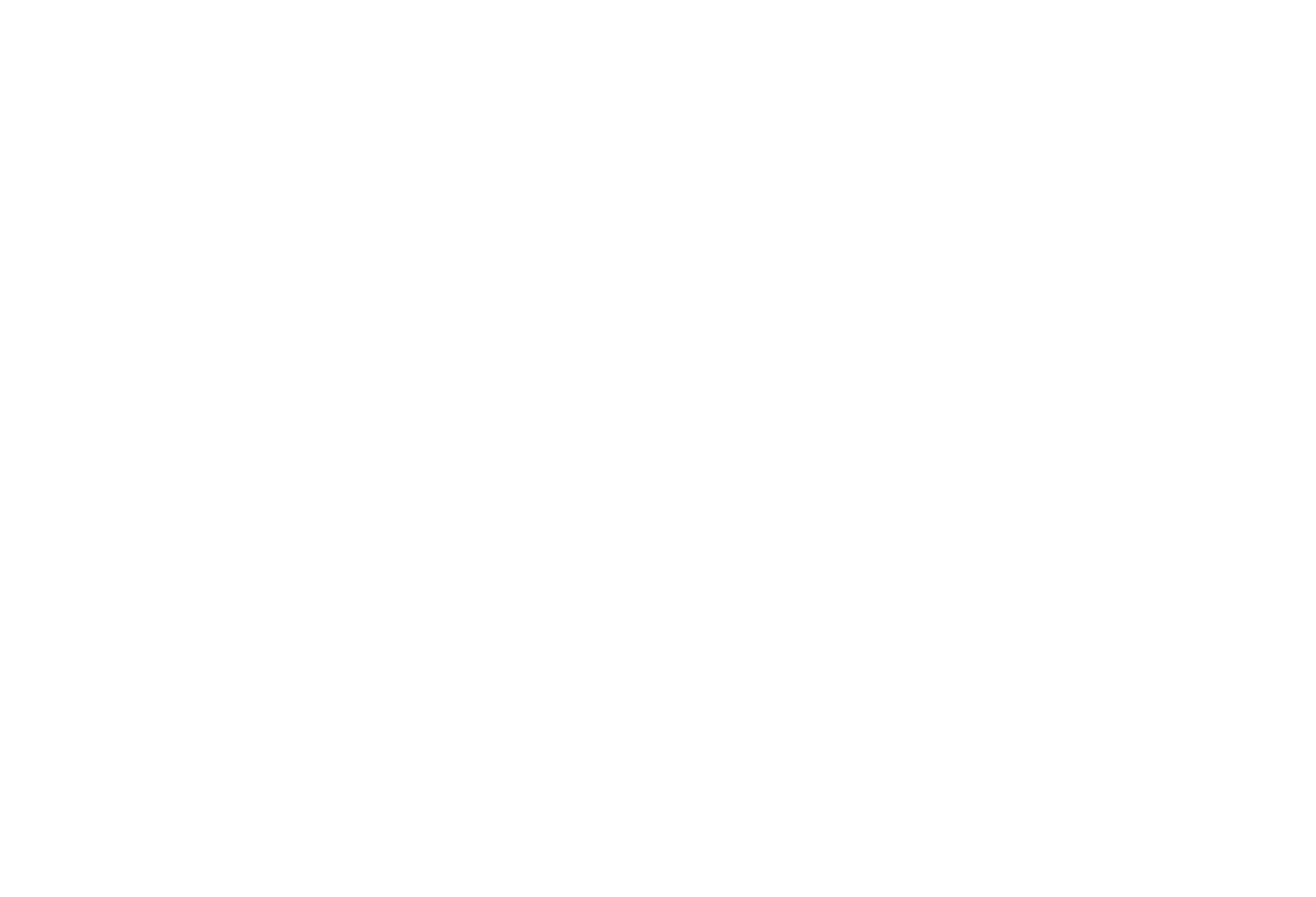Robert Feustel / Gregor Ritschel: Populistische Spiele. Bullshit als politische Strategie
Eine Rezension
DOI:
https://doi.org/10.15460/kommges.2024.25.1.1745Schlagworte:
Rezension, Populismus, Bullshit, Live Action Role Playing, Alternate Reality Game,Redaktion und Begutachtung
Abstract
Eine Rezension
1 Von Fake News, Bullshit und der falschen Freude am Rollenspiel
Wer hat nicht schon einmal die Augen verdreht oder den Kopf geschüttelt, angesichts von offensichtlich frei erfundenen Behauptungen, die man getrost mit dem relativ neuen Begriff „Fake News“ bezeichnen kann? Nicht erst seit Trump zweiter Amtszeit, sondern lange davor bereits muss sich die Öffentlichkeit, müssen sich die Medien und der oder die einfache Medienkonsument:in mit Inhalten auseinandersetzen, auf die der Begriff Falschmeldung im klassischen Sinn nicht mehr so recht passen will. Konnte man bisher (oder eher früher) einmal im Jahr Aprilscherze gut als solche erkennen, und wenn nur am Datum, oder beim sprichwörtlichen Krokodil im Baggersee während der Nachrichten-armen Sommermonate schmunzeln, so muss man sich heute täglich mit so genannten „alternativen Fakten“ auseinandersetzen. Dabei sind alternative Fakten nicht einfach nur eine sich unterscheidende Interpretation auf Basis vorhandener Erkenntnisse, z.B. bezüglich wissenschaftlicher Studien zum Klimawandel (oder der Corona-Pandemie und ihrer medizinischen Dimensionen), sondern sie beanspruchen Wahrheiten zu sein, eben nur alternativ zu den als gesichert geltenden. Man kann den Kopf schütteln, würde sich aber ein Schleudertrauma dabei holen, angesichts der Dichte vieler Behauptungen und so geäußerten vermeintlichen „anderen Wahrheiten“. Einiges davon ist leicht zu erkennen, anderes eher schwieriger. Das hindert aber so manche Politiker:in nicht daran, auch coram publico zu behaupten, dass man „Fakten anders fühle“, selbst wenn der Beweis offen da liegt. Und von den Möglichkeiten, Verschwörungserzählungen in diese Diskussionen um die wirklichen Wahrheiten und Alternativen Realitäten mit einzubringen, habe ich noch gar nicht gesprochen.
Analysen zu dem Phänomen hat es in den letzten Jahren einige gegeben. Nils Kumkar (2022) hat das Buch „Alternative Fakten“ publiziert, jetzt haben Robert Feustel und Gregor Ritschel, zwei Soziologen und Politologen eine weitere Veröffentlichung dazu gefügt: „Populistische Spiele“ (Feustel & Ritschel, 2025). Der Fokus liegt in diesem Buch auf dem, was die beiden mit „Bullshit“ bezeichnen, übersetzt am besten mit „Blödsinn“ oder „Unsinn“, welcher von ihnen als Teil eines Spiels verstanden wird – worin auch ihre Analyse ihren Ausgangs- und Fokuspunkt findet.
Um den vielen kleinen und großen, irrigen bis hanebüchenen Unsinn und seine dahinter stehenden Strategien zu analysieren, greifen sie auf die Figur eines so genannten Alternative Reality Games (ARG) zurück. Solche ARG oder in der Live-Version auch als Life Action Role Plays (LARPs) bekannte Spiele gibt es durchaus und sie sind ihrer Idee nach harmlos. Bei den LARPs kommen teilweise mehrere 1.000 Menschen zusammen, um in einer fiktiven, mittelalterlichen Fantasiewelt zu spielen, ihre angenommen Rollen auszuleben, inklusive der Kostüme, der inneren Logiken der Spiele und der entsprechenden Geschichte für das Spiel. Das Spiel, so halten die Autoren fest, eigne sich für die Analyse so gut, weil dort zwei eigentlich schwer vereinbare Dinge aufeinandertreffen: der offenkundige Unsinn und die wirklichkeitsfremde Fiktion (S. 14). Ihr erstes Beispiel für diese Art der dort geschaffenen Hyperrealität ist ganz im Diesseits verortet und nicht bei den Erzählungen von Reptilien, die den Staat unterwandert haben oder ähnlichen, eher dem science-horror-fiction-Genre zuzuordnenden Narrativen: es geht um Reichsbürger und ein mutmaßliches Königreich Deutschland. Die Schilderung einer Krönungszeremonie von Peter Fitzek, selbst ernannter König von Deutschland, in einer Lagerhalle irgendwo in Deutschland, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Das Rollenspiel Reichsbürger, so machen die beiden Autoren deutlich, ist Spiel und Ernst zugleich. Man muss es nicht glauben und die Einbrüche der Realität sind überall zu spüren – indem aber alle mitmachen und sich dem Spiel hingeben, erzeugen sie jene Realität, an die sie dann selbst glauben. Dass es funktioniert, hätte seine Gründe vor allem in der affektiven Aufladung des Spieles – die Autoren führen den affective turn als analytische Folie an (S. 42). Affekte und Affektpolitik spielen auch im weiteren bei der Analyse eine wichtige Rolle, denn es geht um Glaube, um Wissen, um Realitäten zwischen Fiktion und Wirklichkeit, um Hyperrealität und immer wieder um den Aberglauben.
Neben den Reichsbürgern wird das Phänomen QAnon als weiteres Beispiel genutzt, um über Hyperrealitäten, Wirklichkeiten und Fiktion nachzudenken. Vor allem aber darüber, wie diese nicht nur auf den ersten Blick offensichtlichen Unsinnigkeiten verfangen und im politischen Alltag nicht nur der USA die Debatten bestimmen und bisherige politische Kulturen aushöhlen, frei nach dem Motto: Was viral geht, das wird wahr (S. 75). Trump und die USA sind immer wieder Bezugspunkt der Analyse, aber diese ist bei weitem nicht darauf beschränkt. Der Bullshit funktioniert überall. Den Leser:innen von heute sind die Beispiele keineswegs fremd – sie selbst können wahrscheinlich weitere dazufügen. Und auch wenn das Buch 2023-2024 geschrieben wurde, so sind die Schlussfolgerungen keinesfalls überholt. Die ersten Monate der Trump-Präsidentschaft zeigen es deutlich, der Bundestagswahlkampf 20224/25 in Deutschland ebenfalls: Bullshit, wo man hinschaut. Und überall der gleiche Effekt: die Wahrheit an sich wird unwichtiger, auch weil Bullshit eben keine Lüge ist, sondern etwas darüber hinaus. Die Wahrheit wird eine Fiktion unter anderen. Das ist beängstigend und die Analyse von Feustel und Ritschel beruhigt da keinesfalls, hilft aber zu verstehen und bietet mit den vier Konturen des Unsinns in Kapitel 4 so etwas wie eine Anleitung zum Verstehen diesen Unsinns an. Und das ist nötig, wenn man bedenkt, dass das Spiel nur den eigentlichen Ernst verdecken soll. Mit dem Bullshit soll, so die Autoren, nämlich etwas vorbereitet werden, was mit plumper rechter Rhetorik so wahrscheinlich nicht in dem Maße verfangen würde: die propagierte Feindschaft einer Reihe von Menschen und Gruppen gegenüber.
„Was schließlich von einem Willen zum Spiel vorbereitet und ermöglicht wird, etwa in Form schleichender Enthemmung und Radikalisierung bei digitalen LARPs auf Twitter, mutiert zum profanen wie brutalen Ernst, wenn die Feindschaft übernimmt.“ (S. 108)
Im Ausblick gibt es dann doch noch ein paar „Rezepte“ wie man möglicherweise mit den Bullshit-Strategien umgehen kann, wie man die Triggerpunkte entschärfen kann.
Die 130 Seiten des Buches lohnen sich auf jeden Fall. Robert Feustel und Gregor Ritschel haben eine lesenswerte Analyse vorgelegt. Mit dem Ansatz des Spiels kommt sie theoretisch frisch daher, nimmt aktuelle politische Entwicklungen auf, zeigt die popkulturellen Bezüge der Bullshit-Strategien, die so nur im Milieu der gegenwärtigen digitalen, sozialen Medien und der Rezeptions- und Nutzungsgewohnheiten des politischen Publikums – mithin nahezu alle Bürger:innen – funktionieren können. Dass es Strategien dagegen gibt, ist beruhigend. Ob diese den Weg in die Redaktionen der Presse- und Medienhäuser finden wird, ist fraglich. Aufmerksamkeit verdient diese kurze Analyse dort auf jeden Fall – und in der soziologischen Debatte sowieso. Dann stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob die Gesellschaft gespalten ist, sondern wer ein Interesse an dieser vermeintlichen Spaltung von Gesellschaft hat1. Dem rechten Populismus deshalb einen linken gegenüberzustellen, halten die beiden nicht für klug und ratsam. Ihre Analyse lässt sich auch als ein Plädoyer zu einer konsequenten Abrüstung der Sprache lesen, zur Versachlichung von Debatten, für eine Politik, die nicht auf Affekte setzt, ein Spiel, welches nur denen nutzt, die davon leben, die Wahrheit zu verschieben, ja obsolet zu machen. Es braucht keine Überbietung des Bullshit, sondern seine Einhegung und De-Emotionalisierung von Debatte und Politik, das Spiel sollte dabei Spiel bleiben und nicht dazu dienen, die Grenzen zwischen Fiktion und Realität im politischen Alltag und Leben zu verschieben. Auch dazu ist das Buch, wenn nicht konkrete Anleitung, so doch ein überzeugendes Plädoyer.
2 Über den Autoren
Nils Zurawski ist Privatdozent am Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Hamburg und Mitherausgeber von kommunikation@gesellschaft.
Autor*innenbeiträge
Nils Zurawski hat den Artikel allein verfasst.
Datenverfügbarkeit
Alle relevanten Daten befinden sich innerhalb der Veröffentlichung.
Finanzierung
–
Interessenskonfliktstatement
Die Autor*innen erklären, dass ihre Forschung ohne kommerzielle oder finanzielle Beziehungen durchgeführt wurde, die als potentielle Interessenskonflikte ausgelegt werden können.
Referenzen
Feustel, R. & Ritschel, G. (2025). Populistische Spiele: Bullshit als politische Strategie (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Kumkar, N. C. (2022). Alternative Fakten: zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung (edition suhrkamp) (Originalausgabe.). Berlin: Suhrkamp Verlag.
Kumkar, N. C. & Schimank, U. (2024). Gesellschaftliche Polarisierungen und soziologische Positionierungen. Soziologie, 54(1), 7–33.
0 von Crossref erfasste Zitate
0 von Semantic Scholar erfasste Zitate
Erhalten
Akzeptiert
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenzinformation
Copyright (c) 2025 Nils Zurawski

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.